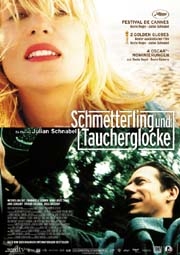
Einmal
läuft Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) nachts durch
den
französischen Wallfahrtsort Lourdes. Eigentlich ist die
Stadt
sonst überfüllt von Pilgern. Jean-Do's (so nennen ihn
seine Freunde) junge Geliebte hat sich von ihm eine
übergroße
Mariafigur gewünscht. Nun steht die Mutter Gottes im
Schlafzimmer
und an Sex ist nicht zu denken. Deswegen ist er auch
allein unterwegs.
 Kaltes
und monotones Neonlicht wird von den Schaufenstern matt
reflektiert.
Es ist ein kurzer Moment der Ruhe und Einsamkeit in seinem
sonst
so ereignisreichen Alltag. Umso erstaunlicher ist es, dass
Jean-Do
sich genau an diesen Augenblick erinnert, als ihn das
Schicksal
mit nahezu unvorstellbarer Härte trifft.
Kaltes
und monotones Neonlicht wird von den Schaufenstern matt
reflektiert.
Es ist ein kurzer Moment der Ruhe und Einsamkeit in seinem
sonst
so ereignisreichen Alltag. Umso erstaunlicher ist es, dass
Jean-Do
sich genau an diesen Augenblick erinnert, als ihn das
Schicksal
mit nahezu unvorstellbarer Härte trifft.
Die gerade erwähnte Szene ist eine von vielen Rückblenden in Julian Schnabels meisterhaftem Film "Schmetterling und Taucherglocke". Der Amerikaner verfilmt damit das tragische Leben des französischen "Elle"-Herausgebers Jean-Dominique Bauby. Nach einem Schlaganfall litt dieser Mann am äußerst seltenen Locked-In-Syndrom. Menschen, die an diesem Syndrom leiden, sind zwar bei vollem Bewusstsein, können jedoch nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Sie sind Eingesperrte im eigenen Körper. Sie sind wie Schmetterlinge in Taucherglocken. Das wahrlich herausragende an Schnabels Film ist, dass er es dem Zuschauer durch seine fulminanten Bilder und den damit verbundenen visuellen Reichtum ermöglicht, in diesen kaum vorstellbaren Zustand der Kommunikationslosigkeit einzudringen. Das ist zu Beginn alles andere als leicht erträglich, doch mit der Zeit sind wir mit Baubys Leiden sehr vertraut.
Die ersten Bilder des Films sind dementsprechend
beklemmend und
vor allem beunruhigend. Dunkel und Hell wechseln in
unregelmäßigen
Abständen. Dann sieht man irgendwann verschwommene und
unscharfe
Gesichter, Konturen und Umrisse. Es ist Jean-Do's Erwachen
und wir
sind mitten drin. Der Kameramann Janusz Kaminski hat
unglaubliche
Arbeit geleistet. Er nähert sich  diesem
schrecklichen Daseinszustand durch die präzise und
konsequente
Kameraführung maximal an. So entsteht eine über weite
Strecken kaum auszuhaltende klaustrophobische Atmosphäre.
Es
dauert auch fast eine halbe Stunde, bis wir Jean-Dominique
Bauby
von Außen betrachten können, und der Moment, in dem er
sich selbst zum ersten Mal sieht (eine kurze Reflektion
während
einer Rollstuhlfahrt) ist ein überwältigender und zutiefst
tragischer.
diesem
schrecklichen Daseinszustand durch die präzise und
konsequente
Kameraführung maximal an. So entsteht eine über weite
Strecken kaum auszuhaltende klaustrophobische Atmosphäre.
Es
dauert auch fast eine halbe Stunde, bis wir Jean-Dominique
Bauby
von Außen betrachten können, und der Moment, in dem er
sich selbst zum ersten Mal sieht (eine kurze Reflektion
während
einer Rollstuhlfahrt) ist ein überwältigender und zutiefst
tragischer.
Jean-Do kann zunächst nicht begreifen, was mit ihm geschieht. Dann verfolgt er den Alltag mit blankem Entsetzen. Aus dem Off kommentiert er das Geschehen mit einem extremen Zynismus. Wenn beispielsweise die Ärzte ihn baden, dann kommt er sich vor wie ein hilfloses Baby. Doch woher kennen wir seine Reaktionen? Wieso wissen wir, was Bauby bewegt oder ärgert? Es ist keinesfalls die alleinige Kopfgeburt eines Drehbuchschreibers. Der reale Bauby lernte schrittweise mit seinem Leiden umzugehen. Jeden Tag wurde er von Logopäden besucht, die ihn zwangen mit der Außenwelt zu kommunizieren. Da er bis auf sein linkes Auge komplett gelähmt war, musste der Journalist einen ziemlich anstrengenden Code erlernen. Über das Blinzeln konnte er sich dann schließlich doch noch von einer totalen Kommunikationslosigkeit lösen. Schließlich schaffte er es auch mit dieser Methode, ein ganzes Buch zu schreiben. Sein literarisches Vermächtnis wurde zum Welterfolg, den Bauby selbst aber nicht mehr ganz miterlebte. Er starb zwei Wochen nach der Veröffentlichung.
 Julian
Schnabels Film zeigt die Entstehung des Buches manchmal
als qualvollen
Vorgang und steigert diesen Eindruck durch die Zen-hafte
Ruhe der
Erzählung. Immer wieder muss die Logopädin Jean-Do das
nach relativer Häufigkeit sortierte Alphabet aufsagen:
"E-R-T-S-L
...", bis er schließlich blinzelt und den Buchstaben
bestätigt. Langsam kommen auch die ersten Besucher ins
Krankenhaus.
Arbeitskollegen, Verleger und Freunde besuchen ihn und
sind mit
der Situation sichtlich überfordert. Immer wieder müssen
sie sich zu ihm herunter bücken, da er seinen Kopf nicht
bewegen
kann. Bauby erfährt, dass er zum Stadtgespräch geworden
ist. Er sei mittlerweile Gemüse, spottet die Konkurrenz.
"Gemüse?
Was für ein Gemüse? Gurken, Karotten oder doch Zwiebeln",
kommentiert er mit dem für ihn so typischen trockenen
Sarkasmus.
Julian
Schnabels Film zeigt die Entstehung des Buches manchmal
als qualvollen
Vorgang und steigert diesen Eindruck durch die Zen-hafte
Ruhe der
Erzählung. Immer wieder muss die Logopädin Jean-Do das
nach relativer Häufigkeit sortierte Alphabet aufsagen:
"E-R-T-S-L
...", bis er schließlich blinzelt und den Buchstaben
bestätigt. Langsam kommen auch die ersten Besucher ins
Krankenhaus.
Arbeitskollegen, Verleger und Freunde besuchen ihn und
sind mit
der Situation sichtlich überfordert. Immer wieder müssen
sie sich zu ihm herunter bücken, da er seinen Kopf nicht
bewegen
kann. Bauby erfährt, dass er zum Stadtgespräch geworden
ist. Er sei mittlerweile Gemüse, spottet die Konkurrenz.
"Gemüse?
Was für ein Gemüse? Gurken, Karotten oder doch Zwiebeln",
kommentiert er mit dem für ihn so typischen trockenen
Sarkasmus.
Jean-Dominique Bauby ist auch Vater von drei Kindern.
Doch als
er sich mit einer Jüngeren einließ, haben sich er und
seine Frau scheiden lassen. Sie und die drei Kinder kommen
ihn häufig
besuchen und man muss schon schlucken, wenn Bauby sich
selbst den
Tod wünscht, da es für ihn ein Unding ist, wenn der eigene
Sohn ihm den Sabber aus dem Gesicht wischt.
Und doch gibt es einen anderen Moment im Film, der an
Intensität
und ergreifender Emotionalität nicht zu überbieten ist:
Die herzzerreißende Szene mit Baubys Vater (ein
exzellenter
Auftritt der europäischen Filmlegende Max von Sydow). Wenn
der Sohn seinen alten Herrn rasiert und der ihm einen
Vortrag über
das Leben und die Liebe hält, beobachtet die Kamera diesen
Vorgang mit einer unvorstellbaren Zartheit. Irgendwann -
nach dem
furchtbaren Schlaganfall - ringt sich der Vater dazu durch
seinen
Sohn anzurufen. Der alte Mann ist sichtlich überfordert
mit
der Situation. Die Übersetzerin am Telefon ermutigt ihn.
Dann
folgt ein zutiefst ergreifender Monolog von Sydows.
Spätestens
jetzt braucht sich keiner seiner Tränen mehr zu schämen.
Trotz seiner zermürbenden Tragik ist Schnabels Film alles
andere als bestürzend und depressiv. Er hat sehr viele
Momente
purer Schönheit und Augenblicke, die vor Humor und Witz
nur
so sprühen. Wenn Bauby von den überdurchschnittlich
hübschen
Krankenschwestern und Logopädinnen betreut wird, leidet
der
einstige Lebemann und Frauenheld furchtbar. "Wenn ich mich
nur  bewegen
könnte!", stöhnt er. Und dann flüchtet er sich
immer wieder in eine Welt, in der er nicht ans Bett
gefesselt ist
- in seine Phantasie. In den Erinnerungen seines
bisherigen Lebens
kommt ihm sogleich alles unwirklich und verschwenderisch
vor. Die
stundenlangen Fotosessions, die vielen Reisen und Flüge,
die
Affären die er mit der Zeit erlebt hat, das alles
befriedigt
ihn nicht mehr.
bewegen
könnte!", stöhnt er. Und dann flüchtet er sich
immer wieder in eine Welt, in der er nicht ans Bett
gefesselt ist
- in seine Phantasie. In den Erinnerungen seines
bisherigen Lebens
kommt ihm sogleich alles unwirklich und verschwenderisch
vor. Die
stundenlangen Fotosessions, die vielen Reisen und Flüge,
die
Affären die er mit der Zeit erlebt hat, das alles
befriedigt
ihn nicht mehr.
Plötzlich fängt Jean-Do an, sich an die Kleinigkeiten
zu klammern. Der Wind der durch die Gräser weht oder die
Pariser
Häuserfassaden, die er aus seinem Cabrio immer nur vorbei
rauschen
sah. Das klingt im ersten Moment alles kitschig und
überhöht.
Aber wenn Bauby von verpassten Chancen spricht - so wie
man es schon
oft von Menschen vernommen hat, die auf ihr unerfülltes
Leben
zurückblicken - dann glaubt man dies sofort, denn man
macht
mit ihm zusammen diesen gesamten Prozess durch. Die
Transformation
vom Bonvivant und Playboy zum nachdenklichen und ruhigen
Menschen
wird nicht auf Biegen und Brechen erzwungen, sondern setzt
sich
langsam wie ein Puzzle vor unseren Augen zusammen.
Das ist auch dem furiosen Hauptdarsteller zu verdanken.
Dem hierzulande
wohl unbekannten Matthieu Almaric glaubt man sowohl die
lebendige
Facette seines Charakters, als auch den paralysierten
Lebensabschnitt
seiner Figur. Bald wird sich Almaric als neuer James
Bond-Bösewicht
sicherlich zum neuen europäischen Top-Darsteller mausern.
Wer
ihn hier gesehen hat, den wird das nicht überraschen.
Man kann die Empörung und die großenteils negativen
Reaktionen der französischen Kritiker auf den Film nicht
nachvollziehen.
Es ist wohl der gekränkte Nationalstolz, da sich ein
Amerikaner
diesem französischen Stoff zugewandt hat. Aber schließlich
hat Schnabel in französischer Sprache gedreht und die
Rollen
fast ausschließlich mit französischen Darstellern besetzt.
Ihm ist dabei ein außergewöhnliches Kunstwerk gelungen:
"Schmetterling und Taucherglocke" ist ein kleines, visuell
höchst inspirierendes Meisterstück.
Wie dieser ungreifbare Christopher McCandless in Sean
Penns überwältigendem
Aussteiger-Drama "Into the Wild"
es erst begreifen musste, dass Glück nur dann etwas zählt,
wenn man es teilen kann, so wird auch Jean-Do in der
denkbar schwärzesten
Stunde seines Lebens verstehen, was es mit dem Geheimnis
des Lebens
auf sich hat. Wir als Außenstehende können uns Baubys
Zustand nur annähern. Wirklich verstehen, wie er sich in
seinen
letzten Lebensjahren gefühlt hat, können wir nicht. Der
Film lässt diese unerreichbare Distanz bestehen und auch
hierfür
gebührt Schnabel großer Respekt. Jedenfalls verlässt
man das Kino auf wackeligen Knien, und doch ist diese
Kinoerfahrung
es alle mal wert. Der Film ist zweifelsohne ein
unauslöschliches
Erlebnis und einer jener viel zu selten gewordenen
Glücksmomente
im Kino, nach denen man sich immer wieder sehnt.
Neuen Kommentar hinzufügen