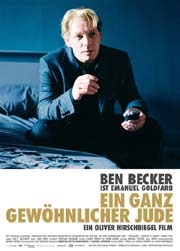
Oliver Hirschbiegel ist ein Filmemacher, der sich Respekt und Anerkennung
wirklich verdient hat. Bekannt geworden mit diversen preisgekrönten
TV-Filmen, darunter das grandiose Zwei-Personen-Kammerspiel "Das
Urteil", inszenierte er anschließend mit "Das
Experiment" und "Der
Untergang" zwei der besten und wichtigsten deutschen Filme
im neuen Jahrtausend. Nun hat er gerade "The Visiting"
(ein Remake des SciFi-Klassikers "Invasion of the Body Snatchers")
mit Nicole Kidman abgedreht, was ihn zum zweiten erfolgreichen Regie-Export
von Deutschland nach Hollywood binnen wenigen Monaten macht (nach
Robert Schwentke,  "Flight
Plan"). Doch zwischen seinen immer größer werdenden
Mainstream-Produktionen gönnt sich Hirschbiegel auch immer
wieder eine Atempause, die ihn zurück zum überschaubaren
Rahmen des TV-Kammerspiels führt. Das Endergebnis ist dann
für gewöhnlich so gut, dass sich sogar noch ein Kino-Verleih
dafür findet. Das war schon bei der Hannelore-Elsner-Soloshow
"Mein letzter Film" so, und das trifft auch auf Hirschbiegels
neuestes Werk mit Ben Becker in der (fast) einzigen Rolle zu.
"Flight
Plan"). Doch zwischen seinen immer größer werdenden
Mainstream-Produktionen gönnt sich Hirschbiegel auch immer
wieder eine Atempause, die ihn zurück zum überschaubaren
Rahmen des TV-Kammerspiels führt. Das Endergebnis ist dann
für gewöhnlich so gut, dass sich sogar noch ein Kino-Verleih
dafür findet. Das war schon bei der Hannelore-Elsner-Soloshow
"Mein letzter Film" so, und das trifft auch auf Hirschbiegels
neuestes Werk mit Ben Becker in der (fast) einzigen Rolle zu.
"Ein ganz gewöhnlicher Jude" ist die Adaption eines Romans von Charles Lewinsky (auch wenn der Monolog des Protagonisten, der im Prinzip die gesamte Handlung füllt, sehr wie ein Theaterstück anmutet) und handelt von dem Journalisten Emanuel Goldfarb, der von einem Mitglied seiner Gemeinde darum gebeten wird, die Einladung eines Lehrers anzunehmen und vor einer Schulklasse über sein Leben als Jude in Deutschland zu sprechen. Emanuel lehnt zunächst kategorisch ab. Er will sich nicht mit dem Thema auseinander setzen, möchte nicht in der Öffentlichkeit als "der Jude" da stehen, gebranntmarkt mit allen verschämten Vorurteilen, betrachtet mit einem ewigen Blick peinlicher Berührtheit. Der titelgebende "ganz gewöhnliche Jude" möchte Emanuel sein, ein Mensch wie jeder andere auf der Straße, dessen Religionszugehörigkeit als genauso wichtig und bedeutungsvoll betrachtet wird wie die vom Gemüseverkäufer - nämlich gar nicht. Warum das in Deutschland auch heutzutage einfach nicht möglich ist, und warum er deshalb nicht in seinen Unterricht kommen wird, das will Emanuel dem Lehrer in einem Brief schreiben - doch der Schreibprozess bewegt sich unweigerlich vom Allgemeinen ins Persönliche, und bald analysiert Emanuel nicht mehr "nur" die generelle Situation als Jude in Deutschland, sondern auch seine ganz eigene Geschichte.
 Dieser
Aufbruch ins Persönliche markiert ziemlich genau die Halbzeit
von "Ein ganz gewöhnlicher Jude" und ist ein gutes
Beispiel dafür, wie hervorragend Hirschbiegel sein erzählerisches
Handwerk versteht. So interessant und einsichtsvoll Emanuels Ausführungen
in der ersten Filmhälfte sind - betreffen sie einen doch auch
ganz direkt, schließlich redet er über das leider ziemlich
allgemeingültige, typische Verhaltensmuster der wohlmeinenden,
aber berührungsängstlichen Bevölkerungsmehrheit in
Deutschland - ab einem gewissen Punkt beginnt sich der Zuschauer
nach einer Wendung zu sehnen. Dass diese fast gleichzeitig mit dem
ersten leisen Gedanken, mal auf die Uhr zu schauen, kommt, zeugt
von Hirschbiegels großartigem Talent für Timing und Tempo.
Dieser
Aufbruch ins Persönliche markiert ziemlich genau die Halbzeit
von "Ein ganz gewöhnlicher Jude" und ist ein gutes
Beispiel dafür, wie hervorragend Hirschbiegel sein erzählerisches
Handwerk versteht. So interessant und einsichtsvoll Emanuels Ausführungen
in der ersten Filmhälfte sind - betreffen sie einen doch auch
ganz direkt, schließlich redet er über das leider ziemlich
allgemeingültige, typische Verhaltensmuster der wohlmeinenden,
aber berührungsängstlichen Bevölkerungsmehrheit in
Deutschland - ab einem gewissen Punkt beginnt sich der Zuschauer
nach einer Wendung zu sehnen. Dass diese fast gleichzeitig mit dem
ersten leisen Gedanken, mal auf die Uhr zu schauen, kommt, zeugt
von Hirschbiegels großartigem Talent für Timing und Tempo.
Fast 90 Minuten mit einer konstant redenden Person in einer Wohnung
- das dieses Szenario für viele potentielle Zuschauer erstmal
abschreckend klingt, ist verständlich. Aber genau hier liegt
ja auch die Herausforderung für den Regisseur einer solchen
Vorlage: Das Buch als Film funktionieren und auch die Bilder ihren
Teil erzählen zu lassen. Gerade in dieser Hinsicht erweist
sich "Ein ganz gewöhnlicher Jude" als heimliches
Meisterstück, denn wie Hirschbiegel mit elegant eingeflochtenen
Ortswechseln innerhalb der Wohnung immer wieder neue Situationen
schafft, so dem Film die drohende Stasis nimmt und dabei zusätzlich
über die Gestaltung der Kulisse den Hintergrund und die Persönlichkeit
der Hauptfigur ausschmückt, das grenzt in seiner einfachen
Brillanz manchmal fast an Genie. Wer gedacht hat, dieser Stoff würde
besser in ein Theaterstück passen, wird von Hirschbiegel und
seinen Szenenbildnern eines Besseren belehrt: Soviel Dynamik und
Detailtiefe in der Ausstattung könnte eine Theaterinszenierung
niemals erreichen.
 Die
großartige Leistung von Oliver Hirschbiegel versteckt sich
in den Details der Inszenierung, die von Ben Becker ist offensichtlich:
nicht viele Darsteller in Deutschland könnten diese Rolle überzeugend
meistern, und Becker gelingt es mit Bravour. Auch wenn seine Vorstellung
in den ersten Szenen noch etwas steif erscheint, spielt er sich
im weiteren Verlauf regelrecht heiß, und kann ein paar wirklich
große Momente abliefern: Als Emanuel in seiner schwungvollen
Litanei ganz unerwartet auf das Schicksal seiner Eltern und damit
auf den Holocaust kommt, hält er plötzlich inne und realisiert,
welche gedankliche Tür er gerade geöffnet hat. Wie es
Becker im Folgenden mit zitterndem Schweigen schafft, den inneren
Kampf Emanuels gegen die wieder an die Oberfläche drängenden
Geister der Vergangenheit darzustellen, ist von der schauspielerischen
Leistung her atemberaubend.
Die
großartige Leistung von Oliver Hirschbiegel versteckt sich
in den Details der Inszenierung, die von Ben Becker ist offensichtlich:
nicht viele Darsteller in Deutschland könnten diese Rolle überzeugend
meistern, und Becker gelingt es mit Bravour. Auch wenn seine Vorstellung
in den ersten Szenen noch etwas steif erscheint, spielt er sich
im weiteren Verlauf regelrecht heiß, und kann ein paar wirklich
große Momente abliefern: Als Emanuel in seiner schwungvollen
Litanei ganz unerwartet auf das Schicksal seiner Eltern und damit
auf den Holocaust kommt, hält er plötzlich inne und realisiert,
welche gedankliche Tür er gerade geöffnet hat. Wie es
Becker im Folgenden mit zitterndem Schweigen schafft, den inneren
Kampf Emanuels gegen die wieder an die Oberfläche drängenden
Geister der Vergangenheit darzustellen, ist von der schauspielerischen
Leistung her atemberaubend.
Halten sich die Schauspielleistungen von Becker hier und Elsner
in "Mein letzter Film" ungefähr die Waage, hat im
direkten Vergleich der Filme "Ein ganz gewöhnlicher Jude"
trotzdem deutlich die Nase vorn, weil er das weitaus faszinierendere
Thema zu bieten hat. Charles Lewinskys Buch ist eine verdammt starke
Vorlage, und auch wenn sich Emanuels Ansichten nicht als Allgemeinplatz
für die Befindlichkeit der Juden in Deutschland nehmen lassen
(auch dagegen wehrt er sich schließlich die ganze Zeit), so
gelingt es dennoch, den Zuschauern zu vermitteln, wie es ist, Emanuel
Goldfarb zu sein - und damit eben doch auch, was es bedeutet, ein
Jude in Deutschland zu sein. Tief ins Mark der Wahrheit treffende
Sätze wie "Auschwitz werden die Deutschen den Juden nie
verzeihen" sind wertvolle Denkanstöße, um über
unser gesamtgesellschaftliches als auch ganz persönliches Verhältnis
zum Judentum nachzudenken, und untermauern immer wieder beeindruckend,
wie präzise es Lewinsky gelungen ist, dieses komplizierte Verhältnis
und seinen Auswirkungen auf die Betroffenen einzufangen.
Natürlich wird "Ein ganz gewöhnlicher Jude" aufgrund seines Sujets und seiner minimalistischen Produktion eine Randerscheinung im deutschen Kino bleiben, aber wer sich für großartiges Schauspiel, hervorragende Regie und das in all seiner Komplexität meisterhaft abgehandelte Thema interessiert, findet hier einen Film, der sich Beachtung und Bewunderung redlich verdient hat.
Neuen Kommentar hinzufügen