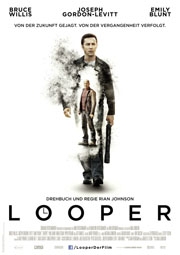
 Robert Ledgard (Antonio Banderas) war einmal ein berühmter Schönheitschirurg, hat sich nach dem Tod seiner Frau aber auf die Recherche verlegt. Sein Projekt: Die Entwicklung einer künstlichen Haut, die widerstandsfähiger ist als normale menschliche Haut. Aber was hat das mit der mysteriösen jungen Frau (Elena Anaya) zu tun, die in seinem Haus wohnt, bedient und bewacht von der Haushälterin Marilia (Marisa Peredes)? Und mit dem jungen Schneider Vicente (Jan Cornet)?
Robert Ledgard (Antonio Banderas) war einmal ein berühmter Schönheitschirurg, hat sich nach dem Tod seiner Frau aber auf die Recherche verlegt. Sein Projekt: Die Entwicklung einer künstlichen Haut, die widerstandsfähiger ist als normale menschliche Haut. Aber was hat das mit der mysteriösen jungen Frau (Elena Anaya) zu tun, die in seinem Haus wohnt, bedient und bewacht von der Haushälterin Marilia (Marisa Peredes)? Und mit dem jungen Schneider Vicente (Jan Cornet)?
Diese mysteriösen Fragen beherrschen „Die Haut, in der ich wohne“. Der Film ist das Resultat von zwei Herren mittlerweile fortgeschrittenen Alters, die sich nochmal der Anarchie und Provokation ihrer jüngeren Jahre zuwenden. Pedro Almodovar war schon immer ein Provokateur, aber in den letzten Jahren nahmen die Provokationen ab, stattdessen vertiefte sich sein Interesse an der filmischen Herkunft und Hommage und einer puren Emotionalität. Wer aber jetzt glaubte, der Almodovar von „Volver“ und „Zerrissene Umarmungen“ würde es sich zu gemütlich machen, dem zeigt er hier noch mal, dass man auch im Alter noch mit Tabubrüchen und Verstörendem von ihm rechnen darf. Und wer ist als Almodovars Komplize besser geeignet als Antonio Banderas, der mit ihm solch provokante Ware wie „Matador“ und „Fessle Mich!“ drehte. Banderas' Zeiten als Hollywood-Herzensbrecher und Actionheld nähern sich ja nun auch langsam ihrem Ende.
"Die Haut, in der ich wohne" ist hinter der Kamera sentimentaler Rückblick und vor der Kamera unsentimentaler Schritt in die Zukunft. Natürlich erfreuen sich die beiden Männer, die in jungen Jahren zusammen sechs Filme gedreht haben, daran nach so langer Zeit wieder zusammen zu arbeiten. Aber damit hat es sich auch mit Sentimentalitäten, inhaltlich und stilistisch vereint ihr neuer Film die am Film Noir, Hitchcock und Renoir (hier kommt ein bisschen Jaques Tourneur dazu) geschulte Stilästhetik von Almodovars letzten Filmen mit der Provokation und Abgründigkeit, die in Filmen wie den vohergenannten Kollaborationen allerorts auftauchten.
 Wie in „Kika“ beginnt auch hier die Geschichte so richtig mit einer Vergewaltigung, und es ist nur Almodovars Sonderstatus als Schwuler, der die Frauen liebt, zu verdanken, dass Vorwürfe der Misogynie hier vermieden werden. „Die Haut, in der ich wohne“ bietet gar zwei (oder zumindest anderthalb) Vergewaltigungen, denen das Fast-Spielerische der vergleichbaren Szene in „Kika“ – in sich auch nicht unproblematisch – komplett abgeht, trotz Vergewaltiger in Tigerkostüm. So ist auch der Ton vorgegeben, ein ausgesprochen düsterer. Den französischen Roman „Mylade“ adaptierend hat Almodovar hier eine derbe und düstere Geschichte auf die Leinwand gebracht, die mit einem Mysterium anfängt, mit einer Vergewaltigung richtig losgeht und dann mit dem Erklären der Hintergründe mit Vollgas zu den Stationen „abgefahren“ und „abgefuckt“ aufbricht.
Wie in „Kika“ beginnt auch hier die Geschichte so richtig mit einer Vergewaltigung, und es ist nur Almodovars Sonderstatus als Schwuler, der die Frauen liebt, zu verdanken, dass Vorwürfe der Misogynie hier vermieden werden. „Die Haut, in der ich wohne“ bietet gar zwei (oder zumindest anderthalb) Vergewaltigungen, denen das Fast-Spielerische der vergleichbaren Szene in „Kika“ – in sich auch nicht unproblematisch – komplett abgeht, trotz Vergewaltiger in Tigerkostüm. So ist auch der Ton vorgegeben, ein ausgesprochen düsterer. Den französischen Roman „Mylade“ adaptierend hat Almodovar hier eine derbe und düstere Geschichte auf die Leinwand gebracht, die mit einem Mysterium anfängt, mit einer Vergewaltigung richtig losgeht und dann mit dem Erklären der Hintergründe mit Vollgas zu den Stationen „abgefahren“ und „abgefuckt“ aufbricht.
Dabei schließt „Die Haut, in der ich wohne“ durchaus an "Zerrissene Umarmungen" und sein Thema der Obsessionen an, aber eben mit noch verstörenderen psychologischen Charakterisierungen. Allen voran dabei Banderas' moderner Frankenstein, der seine Talente zu Zwecken einsetzt, die nicht zwangsläufig dem hippokratischen Eid unterliegen. Was genau Robert hier macht und warum, darf und soll hier natürlich nicht verraten werden, da Almodovar hier alles auf die langsame Entschlüsselung des grundlegenden Mysteriums ausrichtet: Wer ist die junge Frau in schützendem Ganzkörperanzug und was macht sie in Roberts Haus?
Diese Abhängigkeit von Plot ist allerdings auch die größte Schwachstelle von Almodovars neuestem Film, denn dem großen Mysterium wird hier alles untergeordnet, leider auch die emotionale Kraft, die Almodovars letzte Melodramen auszeichneten. Damit die Geschichte funktioniert, muss der Zuschauer auf Distanz gehalten werden, sein Interesse an der Geschichte und sein Investment in deren Figuren ist daher strikt intellektuell. Und da es sich bei so gut wie allen Figuren um unsympathische oder schlichtweg psychopathische Personen handelt, fällt auch das einigermaßen schwer, obwohl die Darsteller hier alle überzeugen, besonders Banderas in seiner abgründigsten Rolle.
Nicht hilfreich beim Involviertsein ist auch, dass die Geschichte spätestens mit dem Plottwist in der Mitte der Handlung immer schwerer goutierbar wird, wenn Almodovar hier gar das in den letzten Jahren populäre Folterhorrorgenre streift und es in unvorhergesehene Richtungen führt. Immerhin schafft Almodovar hier, was ein tumber Slapstickschlächter wie Eli Roth in seinen „Hostel“-Filmen komplett verfehlte: Mehr als jeder Folterporno verstört „Die Haut, in der ich wohne“ nachhaltig mit einem bitterbösen Plottwist, den selbst Genrekenner nicht vorhersehen werden. Warum? So was wie hier muss man sich erstmal ausdenken. Interessant ist das allemal, Unterhaltung dann aber nur noch im weitesten Sinne.
Interessant ist das allemal, Unterhaltung dann aber nur noch im weitesten Sinne.
Am ehesten kann man „Die Haut, in der ich wohne“ denen empfehlen, die vom Mainstream die Nase voll haben und wirklich mal was ganz anderes sehen wollen. Klar, Almodovar bleibt ein ausgefallener Geschmack und ein Fall fürs Kunstkino. Aber hier verbindet er Trash und Kunst auf eine Weise, die sicherlich manch unbedarften Kunstkinogänger vor Probleme stellen wird, besonders nach seinen vergleichweise "netten" letzten Filmen. Aber diese Filme zeigen auch deutlich, was „Die Haut, in der ich wohne“ abseits seiner Grotesken so schwierig macht: Es fehlt ein emotionaler Bezug, ein Dilemma, das den Zuschauer mitfühlen lässt. Die Schlussszene des Films ist da das beste Beispiel: Hier fängt der Film an, sich für seine Figuren und ihr Innenwohnen zu interessieren, und dann ist er auch schon vorbei. Der Film, der der Schlussszene folgen könnte, ist vielleicht nicht so abgefahren, wie das, was wir vorher sahen, aber vielleicht lohnenswerter.
Und so bleibt „Die Haut, in der ich wohne“ ein Experiment, das Almodovar wieder gefährlicher macht, aber nicht unbedingt besser. Immerhin: In einem Jahr, in dem ein echter Mindfuck-Film bisher gefehlt hat, gibt es Almodovar Fans dieser Art von Filmen mal so richtig.
Neuen Kommentar hinzufügen