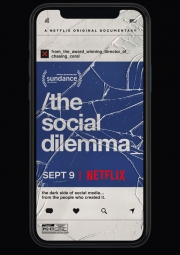
Wer das ungute Gefühl mit sich herum trägt, eventuell zu viel Zeit mit sozialen Medien zu verbringen, und ein gutes Argument sucht, damit aufzuhören, der braucht nur 94 Minuten investieren und sich diese Dokumentation ansehen. Wer danach keinen starken Drang verspürt, sämtliche Social-Media-Apps von seinem Smartphone zu löschen, dem ist definitiv nicht mehr zu helfen.
Warum "The Social Dilemma" (um den etwas ungelenk geratenen deutschen Titel der Kürze halber zu ignorieren) so effektiv geworden ist, hängt maßgeblich damit zusammen, wer hier zur Sprache kommt: Die von Regisseur Jeff Orlowski interviewten Gesprächspartner sind allesamt "mitschuldig" an all den vielschichtigen gesellschaftlichen Problemen, in die die sozialen Medien uns hineinmanövriert haben. Es handelt sich um ehemalige führende Mitarbeiter von Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google etc., die hier quasi zur Beichte antreten. Sie alle eint, dass sie erschrocken darüber sind, zu was für Monstern sich ihre eigene Schöpfung entwickelt hat. Und dass sie ebenso ratlos sind, wie man diesem Monster noch einhalten gebieten soll. Aber: Was genau ist eigentlich das Problem?

Jeff Orlowski montiert gleich zu Beginn seines Films die Reaktionen seiner Interviewpartner auf diese schlichte Frage zusammen, und die allseits sprachlose Reaktion darauf macht deutlich, welche Aufgabe "The Social Dilemma" sich selbst stellt. Denn es ist eben nicht kurz und knackig in einem Satz auf den Punkt zu bringen, was das Problem mit den sozialen Medien ist. Dafür sind ihre Funktionen und Auswirkungen zu vielschichtig, zu weitgreifend, zu komplex. Orlowski versucht trotzdem, in 90 Minuten möglichst die ganze Bandbreite unterzubringen. Und er macht einen herausragenden Job.
"Unterhaltsam" und "kurzweilig" sind Adjektive, die bei solch einer Dokumentation ziemlich deplatziert wirken, macht "The Social Dilemma" doch mehr als deutlich, dass sich die ganze Menschheit mit jedem Tippen auf irgendeinen Like-Button tiefer in einen Höllenschlund manövriert, aus dem es keinen erkennbaren Ausweg mehr gibt. Nichtsdestotrotz rasen die 94 Minuten dieses Films nur so vorbei, während Orlowski einen schwierigen Aspekt nach dem anderen auffächert und schließlich ein ebenso komplexes wie glasklares Bild entwirft, was genau alles das Problem ist. Die Tatsache, dass das Einheimsen eines "Likes" für einen eigenen Post im Gehirn einen Belohnungsreflex auslöst und die einhergehende Dopamin-Ausschüttung ziemlich schnell zu einem faktischen Sucht-Verhalten führt, ist dabei ja schon ein alter Hut. Und auch die Weisheit "Wenn das Produkt nichts kostet, bist du selbst das Produkt" ist ein derart abgegriffener Allgemeinplatz, dass er für Orlowski nur ein Sprungbrett ist, um weitaus tiefergehend zu erläutern, was das eigentliche Produkt von Facebook und Co. ist, und wer seine besten Kunden sind. Kleiner Spoiler: An sehr prägnanter Stelle des Films fällt in Zusammenhang mit der Manipulation der letzten amerikanischen Präsidentenwahl der Schlüsselsatz: "Russland hat Facebook nicht gehackt. Russland hat Facebook genutzt."
"The Social Dilemma" führt mit bedrückender Präzision vor, warum die Algorithmen von Facebook und Konsorten maßgeschneidert dafür sind, um Desinformation zu verbreiten, Meinungsbilder zu radikalisieren und gesellschaftliche Gräben zu zementieren. Er führt allerdings nicht nur die ganz großen Konsequenzen vor Augen, sondern auch die zahllosen kleinen, privaten Tragödien, die durch den Einfluss sozialer Medien befeuert werden und die vor allem die jüngsten Nutzer betreffen - die erste Generation, die schon in frühester Pubertät Social Media nutzt und dadurch beeinflusst wird. So ist zum Beispiel in den letzten zehn Jahren (also seit der massiven Verbreitung von Smartphones) die Rate von Depressionen, Selbstverletzungen und Suiziden unter amerikanischen Teenagern und jungen Erwachsenen massiv in die Höhe geschnellt und hat sich vor allem in der jüngsten Altersgruppe teilweise vervielfacht. Und in der Psychologie gibt es seit kurzer Zeit das neue Krankheitsbild der "Snapchat Dysmorphia" - für Patienten, die zum plastischen Chirurgen gehen, um mehr so auszusehen wie die durch digitale Filter optimierten Fotos in ihren Social-Media-Feeds.

Der einzige Aspekt von "The Social Dilemma", der nicht so richtig gelungen ist, ist Orlowskis Entscheidung, die Auswirkungen der sozialen Medien anhand fiktiver Spielszenen zu illustrieren. Eine typische Mittelschichtsfamilie mit drei Kindern zwischen 12 und 18 Jahren darf hier beispielhaft verdeutlichen, zu welchen Verheerungen der schleichende Einfluss von Social Media führen kann. Das wirkt oft etwas gewollt und stellenweise auch übertrieben in der Inszenierung. Andererseits schaffen es diese Spielszenen aber auch, die Mechanik in den programmierten Algorithmen all dieser Apps sehr plastisch zu verdeutlichen: In Szenen, die ein bisschen an Pixars "Alles steht Kopf" erinnern, schauen wir quasi in die interne Schaltzentrale der Facebook-App, wo die in drei Persönlichkeiten aufgespaltene künstliche Intelligenz ihrem Handwerk nachgeht - nämlich alles daran zu setzen, ihren Nutzer zurück in die App zu locken und dort dann seine Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden, um diese Aufmerksamkeit dann in automatisierten Blitz-Auktionen an Werbekunden zu verkaufen. So anschaulich zu sehen, mit welcher kühlen, maschinellen und von jedem menschlichen Moralempfinden abgekoppelten Logik diese Prozesse ablaufen, kann einem schon mehr als einen Schauder den Rücken runterjagen.
"The Social Dilemma" ist nicht gerade ein Film, der Mut macht, gerade weil hier die ganze Zeit Menschen zu Wort kommen, die bei der Erschaffung dieser Monster an zentraler Stelle mit dabei waren. Wenn diese Leute erzählen, dass sie tagsüber im vollen Bewusstsein über ihr Handeln an süchtigmachenden Algorithmen geschraubt haben, und dann abends zuhause trotzdem nicht in der Lage waren, selbst ihr Smartphone aus der Hand zu legen; oder dass sie ihren eigenen Kindern niemals erlauben würden, soziale Medien zu nutzen; oder dass sie ganz reale Angst vor einem baldigen Bürgerkrieg haben - dann ist es schwierig, hier noch Optimismus und Hoffnung auszumachen. Weil der Film eben auch deutlich macht, dass es keine klar zu benennenden, menschlichen Bösewichte gibt, die dahinter stecken. Niemand der Interviewten hier würde Mark Zuckerberg persönlich die Schuld dafür geben, was sein Unternehmen verursacht hat. Die Kombination aus einem Geschäftsmodell und einer künstlichen Intelligenz, die darauf programmiert wurde, dieses Geschäftsmodell umzusetzen und zu optimieren, hat sich schon längst verselbständigt.

"The Social Dilemma" ist sich bewusst, dass die einzige Waffe in diesem eigentlich nicht mehr zu gewinnenden Krieg gegen dieses Monstrum darin besteht, Aufmerksamkeit und Wissen darum zu verbreiten, was eigentlich wirklich mit uns passiert, wenn wir diese Apps öffnen. Man muss sie deswegen vielleicht nicht zwingend löschen. Aber nachdem man "The Social Dilemma" gesehen hat, wird man ganz sicher ein neues Bewusstsein dafür haben, was man da eigentlich auf seinem Handy tut. Beziehungsweise genauer gesagt: Was da eigentlich mit dir getan wird.
Neuen Kommentar hinzufügen