
In James Cameron's "Aliens" sind 57 Jahre vergangen, bevor Ripley in ihrem Rettungsschiff gefunden und wieder aus dem Tiefschlaf geholt wird. 57 Jahre, in denen nicht nur Ripley's Tochter aufwuchs und starb (ein wichtiges Detail, dass erst in dem 1992 erschienen und 17 Minuten längeren Director's Cut enthalten ist, und aufzeigt, dass Ripleys gesamtes Leben von dem Alien zerstört wurde - weiterhin erhält ihre spätere quasi Mutter-Beziehung zur kleinen Newt hierdurch zusätzliche Bedeutung), sondern auch jener Planet, auf dem in Teil Eins die Alien-Kokons gefunden wurden, besiedelt wurde. Zunächst mag keiner Ripleys Horrormär vom außerirdischen Organismus mit Säure als Blut glauben, doch als der Kontakt zur Kolonie auf besagtem Planet abbricht, wird die unfreiwillige Heldin als Spezialistin mit einem Platoon knallharter Space-Marines losgeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Was der Eliteeinheit auf dem fremden Planeten wiederfährt, darf sich mit Fug und Recht zu den gnadenlos finstersten Apokalypsen im Filmgeschäft zählen. Denn wie zu erwarten war, haben die Aliens die Kolonie zur Brutstätte umfunktioniert. Einzige Überlebende ist das kleine Mädchen Rebecca, genannt Newt, die sich wie durch ein Wunder wochenlang vor den Killerwesen verstecken konnte. Ihren Gegner zunächst leichtsinnig unterschätzend, wird für die Marines die vermeintliche Standard-Mission schnell zum Himmelfahrtskommando, in dem es ums nackte Überleben geht - und die Chancen stehen alles andere als gut.
Auch wenn die Fortsetzung deutlich länger ausfällt als das Original (der Director's Cut läuft sogar knapp über zweieinhalb Stunden) setzt die stramme Tempoerhöhung wesentlich früher ein, was Sinn macht: Aus dem Original ist die Alien-Spezies und ihre Eigenheiten weithin bekannt, in der Fortsetzung will das Publikum Action sehen - und bekommt diese auch serviert. So ist "Aliens" weitaus mainstreamiger inszeniert als sein Vorgänger und setzt auf einen konventionelleren Aufbau, vor allem in Bezug auf die Figuren: Mit dem Platoon, seinem Begleitpersonal und Newt finden sich im zweiten Teil ungefähr doppelt so viele Protagonisten wie im Original  ein, und daher läuft die Charakterentwicklung hier auch direkter und einfacher ab. Kristallisierten sich in "Alien" die Eigenschaften der Figuren nur langsam heraus, so dass über die längste Zeit kein eindeutiger Sympathieträger zu erkennen war (was eindeutig zu den Stärken des Films gehört: Da Ripley als Heldin erst sehr spät zu erkennen ist, bleibt der Spannungsbogen "Wer wird überleben?" so lange wie möglich erhalten), weiß man bei "Aliens" schon nach der Aufsteh- und Frühstückssequenz im Raumtransporter Bescheid, welche Figur welche Funktion einnimmt. Sympathiewerte und Aufmerksamkeit werden klar verteilt, und so kann es sich Cameron auch erlauben, beim ersten überstürzten Angriff auf die Aliens das halbe Platoon draufgehen zu lassen. War in Teil Eins die Bewertung der Verluste noch quantitativer Natur - bei nur sieben Besatzungsmitgliedern zählte jeder gleich, der Charakter der Figuren war da eher irrelevant (daher brauchte man auch keine Identifikationsfigur) - fällt sie in der Fortsetzung qualitativ aus: Cameron etabliert Charaktere, deren Funktion letztlich ihre Position in der dramatischen Sterbefolge bestimmt - stereotype Actionfilm-Strukturen, die den Film in gewisser Weise berechenbarer machen, aber hier vorbildlich ausgeführt werden.
ein, und daher läuft die Charakterentwicklung hier auch direkter und einfacher ab. Kristallisierten sich in "Alien" die Eigenschaften der Figuren nur langsam heraus, so dass über die längste Zeit kein eindeutiger Sympathieträger zu erkennen war (was eindeutig zu den Stärken des Films gehört: Da Ripley als Heldin erst sehr spät zu erkennen ist, bleibt der Spannungsbogen "Wer wird überleben?" so lange wie möglich erhalten), weiß man bei "Aliens" schon nach der Aufsteh- und Frühstückssequenz im Raumtransporter Bescheid, welche Figur welche Funktion einnimmt. Sympathiewerte und Aufmerksamkeit werden klar verteilt, und so kann es sich Cameron auch erlauben, beim ersten überstürzten Angriff auf die Aliens das halbe Platoon draufgehen zu lassen. War in Teil Eins die Bewertung der Verluste noch quantitativer Natur - bei nur sieben Besatzungsmitgliedern zählte jeder gleich, der Charakter der Figuren war da eher irrelevant (daher brauchte man auch keine Identifikationsfigur) - fällt sie in der Fortsetzung qualitativ aus: Cameron etabliert Charaktere, deren Funktion letztlich ihre Position in der dramatischen Sterbefolge bestimmt - stereotype Actionfilm-Strukturen, die den Film in gewisser Weise berechenbarer machen, aber hier vorbildlich ausgeführt werden.
In der Tat sticht "Aliens" nicht wegen inszenatorischer Innovationen hervor, sondern vor allem durch seine beinahe perfekte Ausführung. Cameron's Fortsetzung der Alien-Saga ist weitaus glatter, wandelt die düstere Zukunftsvision in einen stark action-betonten quasi Kriegsfilm um, und schraubt die pessimistischen Botschaften aus Teil Eins deutlich herunter: Das unsichtbare Böse der allmächtigen Cooperation bekommt in diesem Film nicht nur einen Namen (Weyland Youtani heißt der Konzern nun), sondern mit dem Firmenvertreter Burke (Paul Reiser) auch ein Gesicht, in dem sich schließlich auch die Schuld am gesamten Unheil personifiziert: Die Bedrohlichkeit des Großkonzerns nimmt ab, es ist der einzelne erfolgsgeile Mitarbeiter, der die Katastrophe heraufbeschwört. In ähnlicher Weise relativiert Cameron auch die Skepsis gegenüber der künstlichen Intelligenz, die in Teil Eins noch überdeutlich war: Der Android Bishop (Lance Henriksen) in "Aliens" gehört diesmal zu den eindeutig Guten und wird zu Ripleys wichtigstem Verbündeten. Diese Abänderung der 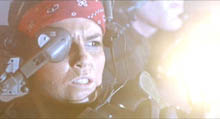 Technik-Feindlichkeit teilt "Aliens" übrigens mit Cameron's Fortsetzung seines eigenen "Terminator", und auch Ripley als weibliche Rambo-Version - in einem Arm ein Kind, im anderen ein dickes Maschinengewehr - kann mit Fug und Recht als geistige Vorläuferin der neuen, knallharten Sarah Connor in "Terminator 2" gesehen werden, und somit als Prototyp der nach wie vor sehr kleinen Riege großer Action-Heldinnen.
Technik-Feindlichkeit teilt "Aliens" übrigens mit Cameron's Fortsetzung seines eigenen "Terminator", und auch Ripley als weibliche Rambo-Version - in einem Arm ein Kind, im anderen ein dickes Maschinengewehr - kann mit Fug und Recht als geistige Vorläuferin der neuen, knallharten Sarah Connor in "Terminator 2" gesehen werden, und somit als Prototyp der nach wie vor sehr kleinen Riege großer Action-Heldinnen.
So mausert sich "Aliens" weniger zum SciFi-Meilenstein als zum Actionfilm par excellence. Er besticht schlichtweg in allen Belangen durch Ausnahmequalität, was sich auch in sieben Oscar-Nominierungen nieder schlug, eine davon sogar für Sigourney Weaver als beste Darstellerin - und das, obwohl Darsteller-Leistungen in solcherlei Genre-Produkt von Preisverleihern immer sehr stiefmütterlich behandelt werden. In der Tat hilft ein grandioses Ensemble Cameron bei der Kreierung einer denkwürdigen Riege an markanten Nebenfiguren, von dem nachdenklichen Corporal Hicks ("Terminator"-Veteran Michael Biehn) über die muskelbepackte Powerfrau Vasquez (Cameron-Glücksbringer Jenette Goldstein, die auch in "T2" und "Titanic" Mini-Auftritte hatte) hin zu der kleinen Carrie Henn, die als Newt ihre einzige Filmrolle spielte und eine der besten Kindesvorstellungen überhaupt abliefert. Ohnehin ist diese Figur, die mit ihrem kindlichen Gemüt mehr Schrecken erlebt hat, als sich die meisten Erwachsenen überhaupt vorstellen können, ein funktionaler Geniestreich in Camerons Skript, da sie als Tochter-Ersatz für Ripley der großen Heldin auch einen privat-emotionalen Grund für den entschossenen Kampf gegen die Aliens gibt. Auch gerade durch diese zusätzliche Dimension erhält das finale "Big Mama"-Duell zwischen Ripley und dem Alien-Muttertier seine enorme Tragweite. Hier kämpft eine stellvertretende Menschenmutter ums Überleben ihrer symbolischen Kleinfamilie - und damit auch um die Daseinsberechtigung ihrer Art im Weltraum.
großen Heldin auch einen privat-emotionalen Grund für den entschossenen Kampf gegen die Aliens gibt. Auch gerade durch diese zusätzliche Dimension erhält das finale "Big Mama"-Duell zwischen Ripley und dem Alien-Muttertier seine enorme Tragweite. Hier kämpft eine stellvertretende Menschenmutter ums Überleben ihrer symbolischen Kleinfamilie - und damit auch um die Daseinsberechtigung ihrer Art im Weltraum.
Was von "Aliens" aber zumeist im Gedächtnis bleibt sind nicht diese metaphorischen Details, sondern die schiere Intensität des Films. Vom ersten Marine-Fuß auf dem fremden Planeten bis zur ersten Sekunde des Abspanns findet der Zuschauer keine ruhige Minute, wird von der erdrückenden Atmosphäre hineingezogen in die Verzweiflung, die pausenlose Bedrohung, die Paranoia. Cameron entwirft alptraumhafte Szenarien von Ausweglosigkeit, wie die denkwürdige Szene, in der die wenigen Überlebenden hinter verschweißter Tür auf ihren Bewegungsmeldern die herannahenden Aliens beobachten,  um dann festzustellen, dass sich diese nicht vor der Tür, sondern in der Belüftungsebene über ihnen befinden. Das Endergebnis ist eine gnadenlos packende Horrorvision, an deren Ende auch jeder Zuschauer erschöpft und ausgelaugt ist. Bei aller Begradigung des zuvor sperrigen Alien-Konzepts: Cameron's Fortsetzung setzte Maßstäbe in seiner Wirkung auf die Nerven des Publikums, und ist so nicht nur einer der besten Actionfilme überhaupt, sondern auch einer der Sorte, die andere Regisseure liebend gerne nachmachen - und so dementsprechend müde Kopien fabrizieren.
um dann festzustellen, dass sich diese nicht vor der Tür, sondern in der Belüftungsebene über ihnen befinden. Das Endergebnis ist eine gnadenlos packende Horrorvision, an deren Ende auch jeder Zuschauer erschöpft und ausgelaugt ist. Bei aller Begradigung des zuvor sperrigen Alien-Konzepts: Cameron's Fortsetzung setzte Maßstäbe in seiner Wirkung auf die Nerven des Publikums, und ist so nicht nur einer der besten Actionfilme überhaupt, sondern auch einer der Sorte, die andere Regisseure liebend gerne nachmachen - und so dementsprechend müde Kopien fabrizieren.
Die Alien-Saga fand 1992 und 1997 noch zwei weitere Fortsetzungen, die inhaltlich weit schwächer ausfielen, mit ihren Vorgängern aber eines gemeinsam hatten: Den ersten großen internationalen Auftritt zweier visionärer Regisseure. David Fincher und Jean-Pierre Jeunet lieferten später mit "Fight Club" und "Die fabelhafte Welt der Amelie" zwei der beeindruckendsten Filme der letzten Jahre ab. So hielt die Alien-Saga zumindest stilistisch ihre wegweisende Ausnahmeposition im Science-Fiction-Bereich, den sie vor allem visuell geprägt hat wie keine andere Franchise. Und da sich Gerüchte über einen möglichen fünften Teil ähnlich hartnäckig halten wie die ewigen Ankündigungen über "Indiana Jones 4" hat diese Geschichte ihr Ende vielleicht doch noch nicht erreicht
Neuen Kommentar hinzufügen