|
 Michael
Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der
dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich
bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug
gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung
der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich
auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit
gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John
Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino
wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine
standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle
des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend
umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte
sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt
noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit
seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft
würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von
Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker
ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil
hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher
jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber
das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit
des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:
Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so
gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme
gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter
haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen
verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen
bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen
ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel
sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern
eindeutig auf notwendig. Michael
Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der
dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich
bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug
gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung
der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich
auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit
gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John
Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino
wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine
standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle
des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend
umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte
sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt
noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit
seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft
würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von
Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker
ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil
hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher
jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber
das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit
des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:
Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so
gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme
gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter
haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen
verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen
bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen
ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel
sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern
eindeutig auf notwendig.
Natürlich ist sein Vorgehen manchmal recht vorhersehbar und
platt, natürlich ist das populistisch. Wer aber jetzt hier
die Stimme erhebt von wegen Populismus, Simplifizierung komplexer
Sachverhalte etc., der möge kurz innehalten und mal darüber
nachdenken, wie viel Populismus und einfachste Betrachtungsweisen
die amerikanische Propagandamaschinerie uns in den letzten zwei
Jahren beschert hat, um den Rest der Welt vom ehrenwerten Vorhaben
der Weltpolizei aus Amiland zu überzeugen. Wenn dies die einzige
Gegenpropaganda ist, die ähnlich großen Einfluss nimmt
wie die gleichgeschalteten US-Medien, dann nur her damit.
Abgesehen von seinem persönlichen Kommentar, der von sauwütend
bis sarkastisch reicht, lässt Moore in seinem Anti-Bush-Agitprop-Film
"Fahrenheit 9/11" vor allem Bilder sprechen. Bilder, wie
sie Fernsehkameras aufzeichnen, bevor sie auf Sendung gehen. Und
die zeigen nun einmal besser als jeder Kommentar, was für Herren
sich da anmaßen, über Krieg und Frieden zu bestimmen.
Unglaublich und eklig, wie Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz
seinen Kamm mit Spucke präpariert und schließlich die
widerspenstigen Haare mit ein bisschen Rotze in der Hand zu bändigen
versucht. Gespenstisch und grotesk, wie Bush wie ein Schmierenkomödiant
Sekunden vor der Liveschaltung, in der er den Beginn des Irak-Krieges
verkündete, eine ganze Reihe Grimassen und Gesichtsausdrücke
ausprobiert. Schlüsselszene aber ist der Mitschnitt von Bushs
Reaktion auf  die
Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.
Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen
Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,
als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is
under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der
Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen
Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann
der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält
und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft
doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen
Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes
Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres
ist der Mann aus Texas. die
Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.
Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen
Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,
als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is
under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der
Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen
Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann
der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält
und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft
doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen
Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes
Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres
ist der Mann aus Texas.
Wie im Vorgänger "Bowling
for Columbine" liefert Moore auch hier ein paar äußerst
explosive Thesen, und ähnlich wie dort geht es um Angst als
Machtinstrument. Indem die amerikanische Regierung ihrem Volk konstante
Gefahr vorgaukelt, die es dringend zu bekämpfen gilt, lenken
sie von der schon lange im Hinterkopf gehaltenen Beschneidung der
Bürgerrechte und den faktisch falschen Kriegsgründen ab.
 Ein
Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber
sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während
so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,
erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush
ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und
seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.
Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende
und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch
ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"
vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es
nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,
denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte
geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.
Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber
die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,
dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er
erreichen wollte. Ein
Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber
sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während
so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,
erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush
ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und
seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.
Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende
und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch
ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"
vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es
nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,
denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte
geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.
Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber
die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,
dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er
erreichen wollte.
Allerdings muss man jenseits der hehren Ziele konstatieren, dass
"Fahrenheit 9/11" filmisch nur größtenteils
gelungen ist. Ob Moores patentierte Präsentationsform erste
Ermüdungserscheinungen zeigt oder die Menschen im Schnittraum
keinen richtig guten Tag hatten: Tatsache ist, dass es Moore nicht
gelingt, seinem Film einen richtigen Fluss zu geben, so dass es
bei der episodischen Form durchaus den einen oder anderen dramaturgischen
Hänger gibt. So ist etwa die Episode um den einsamen Strandwächter
Oregons witzig und interessant, aber schlecht eingebunden.
 Auch
wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er
für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,
startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner
typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,
die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.
Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.
Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen
Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche
Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was
ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige
Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden
haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist. Auch
wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er
für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,
startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner
typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,
die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.
Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.
Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen
Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche
Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was
ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige
Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden
haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.
Der Film hat auch Schwierigkeiten, einen einheitlichen Ton zu halten,
wenngleich dies im Ernstfall sogar mehr Stärke als Schwäche
ist, denn wer zwei Stunden Bush-Bashing in Reinkultur erwartet,
der wird - je nach Disposition - enttäuscht oder positiv überrascht.
Klar, im Endeffekt führt Moore alles auf seinen Erzfeind zurück,
verzichtet aber auf allzu Plumpes und einen Exklusivfokus auf den
oft  hilflos
wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade
in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens
mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen
in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden
Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der
Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,
die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und
Vertrauen verlieren. hilflos
wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade
in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens
mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen
in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden
Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der
Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,
die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und
Vertrauen verlieren.
Trotz von der US-Regierung am liebsten zensierten Bildern von zerfetzten
irakischen Babies: die traurigsten, deprimierendsten Bilder sind
die Milchgesichter der amerikanischen Kindersoldaten. Jene unbedarfte
Burschen, die sich mit Rockmusik aufpuschen und zu den Klängen
von "Fire Water Burn" der Bloodhound Gang irakische Wohnviertel
in Schutt und Asche legen. Hiernach wird man das zentrale "Burn,
Motherfucker, Burn!" kaum noch ohne Schaudern mitgröhlen
können. Und vor allem jene Burschen, die sich verwirrt fragen,
warum die irakische Bevölkerung ihnen mit Hass begegnet. Wem
es an grundlegender Bildung mangelt und wer vom Vaterland von vorn
bis hinten belogen wird, dem kann da nur das Verständnis und
die Distanz fehlen. Dass gerade das Fußvolk, die Soldaten,
die im Krieg verwundet und verletzt werden, die größten
Opfer der Lügen von Bush & Co. sind, ist eine der zentralen
Aussagen dieses Films. Und so erweist sich Moore doch als der Vertreter
des kleinen Mannes, der nicht akzeptiert, das Machtstreben und Profitgier
einiger stupid white men in führenden Positionen das
Leben tausender Unschuldiger zerstört.
 Bezeichnend
ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,
welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial
schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur
ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige
Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet
Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten
es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen
umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für
die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,
dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).
In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht
jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während
Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die
Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,
Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber
selten so deutlich vorgeführt wie hier. Bezeichnend
ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,
welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial
schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur
ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige
Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet
Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten
es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen
umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für
die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,
dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).
In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht
jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während
Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die
Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,
Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber
selten so deutlich vorgeführt wie hier.
Insgesamt ist "Fahrenheit 9/11" trotz hemmungslos subjektiver
Sichtweise ein erstaunlich ausgeglichener Film, der nicht nur stumpf
auf Bush einkloppt, sondern viele Themen und Standpunkte streift.
Beizeiten wird es gar ein bisschen viel, was das manchmal etwas
rastlose Hin-und-Herspringen erklärt. Für einige Sachen
wäre trotzdem noch Raum gewesen. Die wahre Achse des Bösen,
die Kriegstreiber hinter Bush (Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld), hätte
man vielleicht noch etwas mehr beleuchten können.
Sei es drum. Ein wie Moore äußerst laut die Stimme erhebender
Aktivist, Countrymusik-Outlaw Steve Earle, erklärte vor noch
nicht allzu langer Zeit: "Es kann niemals unpatriotisch sein,
in einer Demokratie zu hinterfragen, was sein Land tut." Da
hat er Recht, und deswegen ist auch "Fahrenheit 9/11"
ein wichtiger, richtiger Film mit kleinen Schwächen. Das Schlusswort
überlässt Moore Neil Young und seiner Gitarre: "Keep
on rockin' in the free world". Möge es so geschehen.
|
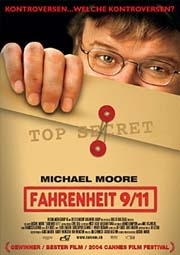
 Michael
Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der
dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich
bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug
gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung
der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich
auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit
gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John
Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino
wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine
standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle
des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend
umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte
sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt
noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit
seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft
würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von
Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker
ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil
hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher
jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber
das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit
des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:
Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so
gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme
gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter
haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen
verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen
bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen
ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel
sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern
eindeutig auf notwendig.
Michael
Moore ist neben seinem Gegenspieler George Walker Bush eine der
dominanten Figuren der letzten zweieinhalb Jahre. Unermüdlich
bestritt der selbsternannte Mann des Volkes seinen Angriffsfeldzug
gegen die wohl arroganteste und am dreistesten lügende US-Regierung
der Geschichte. Neben viel Verehrung seiner Fans gab es natürlich
auch Schelte noch und nöcher. Dabei muss man nicht mal so weit
gehen wie Waffennarr, Rechtsausleger und Kommunistenhasser John
Milius (seinerseits bekannt für, ähem, intelligentes Politkino
wie "Red Dawn"), der Moore ein Arschloch nannte und eine
standrechtliche Erschießung forderte (was die Gefühle
des Konservativen bzw. rechten Lagers in den USA recht treffend
umreißt). Denn bei soviel Medienpräsenz von Moore stellte
sich schon bald die Frage: "Darf man Michael Moore überhaupt
noch gut finden?". Da wird ihm nun vorgeworfen, dass er mit
seinen Filmen und Büchern Geld verdient. Im Musikgeschäft
würde man maulen, er sei nicht mehr ‚indie' genug. Von
Populismusvorwürfen mal ganz zu schweigen. Wo aber Kritiker
ihm Kommerzialität (zu Unrecht, denn Moores genereller Arbeitsstil
hat sich nicht geändert, nur finden seine Filme und Bücher
jetzt mehr breite Beachtung) und Selbstprofilierung (zu Recht, aber
das ist Teil der Kampagne) vorhalten, wird die eigentliche Wichtigkeit
des übergewichtigen Baseballkappenträgers gerne vergessen:
Michael Moore ist vor allem deswegen nötig, weil er der so
gut wie gelähmten politischen Linken in den USA eine Stimme
gibt. Deren subtilere oder meinetwegen auch intelligentere Vertreter
haben sich weitestgehend resigniert in ihr Schneckenhäuschen
verzogen, während Moore richtig Alarm macht. Auch deswegen
bleibt er die einzige wirklich laut zu vernehmende Stimme und deswegen
ist er so wichtig. Er mag in gewissem Sinne ein notwendiges Übel
sein, dabei liegt die Betonung aber nicht auf Übel, sondern
eindeutig auf notwendig.  die
Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.
Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen
Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,
als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is
under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der
Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen
Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann
der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält
und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft
doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen
Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes
Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres
ist der Mann aus Texas.
die
Nachricht, die Twin Towers seien von Flugzeugen getroffen worden.
Da saß er am Morgen des 11. September 2001 bei einem medienwirksamen
Besuch einer texanischen Grundschulklasse und ließ sich vorlesen,
als ihm ein Berater ins Ohr flüsterte: "The nation is
under attack". Schock ist verständlich. Auch Momente der
Hilflosigkeit, der Fassungslosigkeit. Das sei ihm wie jedem anderen
Menschen zugestanden. Dass sich der vorgeblich mächtigste Mann
der Welt aber geschlagene sieben Minuten an einem Kinderbuch festhält
und darauf wartet, dass ihm irgendwer zur Hilfe kommt, das wirft
doch ein treffendes Licht auf Bush junior. Eine - so wird in vielen
Momenten dieses Films klar - inartikulierte Marionette ohne eigenes
Rückgrat und mit den falschen Freunden, das und nichts weiteres
ist der Mann aus Texas.  Ein
Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber
sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während
so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,
erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush
ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und
seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.
Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende
und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch
ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"
vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es
nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,
denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte
geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.
Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber
die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,
dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er
erreichen wollte.
Ein
Problem von "Fahrenheit 9/11" ist hier in Europa aber
sicherlich, dass Moore zu den bereits Bekehrten predigt. Während
so manch einem Amerikaner hier die Augen übergehen dürften,
erzählt der Film einem Zuschauer hierzulande wenig Neues. Bush
ist ein inkompetenter, schon schmerzhaft arroganter Bastard und
seine Amtszeit wird eigentlich durch nur eines geprägt: Lügen.
Aber das hat wie gesagt jeder halbwegs am Weltgeschehen teilnehmende
und politisch mündige Europäer ohne Scheuklappen auch
ohne Moores Hilfe rausgefunden. Daher ist "Fahrenheit 9/11"
vor allem für das amerikanische Publikum wichtig. Da gilt es
nämlich, die entscheidende Überzeugungsarbeit zu leisten,
denn das Land ist noch immer politisch fast genau zur Hälfte
geteilt. Das herausragende Einspielergebnis lässt da hoffen.
Denn wenn durch diesen Film nur ein paar tausend Amerikaner (aber
die entscheidenden in den knappen Wahlstaaten) erreicht werden,
dann hat "Fahrenheit 9/11" bereits das erreicht, was er
erreichen wollte. Auch
wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er
für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,
startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner
typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,
die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.
Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.
Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen
Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche
Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was
ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige
Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden
haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.
Auch
wirkt so manches Moore-Typische ein wenig abgenutzt. Als wolle er
für die Fülle von (gutem) Archivmaterial kompensieren,
startet er in einem Segment der zweiten Filmhälfte eine seiner
typischen Guerilla-Attacken, hier auf amerikanische Kongressabgeordnete,
die Moore zur Entsendung ihrer Kinder in den Krieg bringen möchte.
Diese Aktion ist albern, angestrengt und überflüssig.
Durch solche Mängel wird auch klar, dass der Gewinn der Goldenen
Palme in Cannes doch eher als politisches Zeichen, denn wirkliche
Reflektion über die Filmqualität zu verstehen ist. Was
ja, siehe oben, nicht falsch ist und zeigt, dass der diesjährige
Jury-Präsident Tarantino und seine Konsorten sehr wohl verstanden
haben, wie der Kampf gegen die Regierung zu führen ist.  hilflos
wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade
in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens
mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen
in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden
Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der
Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,
die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und
Vertrauen verlieren.
hilflos
wirkenden Möchtegern-Cowboy. Denn nachdem Moore Bush gerade
in der ersten halben Stunde gehörig welche mitgibt, wird spätestens
mit dem Erreichen des Irakkrieges der Blick von den Verantwortlichen
in oberster Position auf die Opfer gelenkt. Die Opfer auf beiden
Seiten, wohlgemerkt. Denn - und hier zeigt sich, dass Moore in der
Tat ein Patriot ist - es geht ihm gerade um die vielen Amerikaner,
die in einem sinnlosen, unnötigen Krieg Leben, Gesundheit und
Vertrauen verlieren.  Bezeichnend
ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,
welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial
schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur
ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige
Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet
Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten
es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen
umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für
die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,
dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).
In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht
jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während
Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die
Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,
Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber
selten so deutlich vorgeführt wie hier.
Bezeichnend
ist in dieser Hinsicht auch das Rekrutieren von weiterem Kanonenfutter,
welches Moore aufzeigt: Gezielt werden junge Menschen aus sozial
schwachen Schichten und in Gebieten mit zerstörter Industriestruktur
ausgesucht und gelockt. Oft ist für diese die Armee die einzige
Möglichkeit, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und so schneidet
Moore tiefer als reine Polemik gegenüber dem dummen Präsidenten
es tun würde, indem er die strukturellen Probleme des Ganzen
umreißt (und indirekt eine mögliche Erklärung für
die Folterskandale liefert, denn wer selbst zu den Getretenen gehört,
dem fällt es in neuer Machtposition leichter, selbst zuzutreten).
In der Heimat der (Un-)Mutigen und (Un-)Freien ist eben doch nicht
jedermann gleich, wie es die Verfassung trompetet. Während
Privilegierte Machtspiele spielen, werden die Ärmsten an die
Front geschickt, um in diesen blutigen Spielen reihenweise Gesundheit,
Leben oder Würde zu verlieren. Keine neue Erkenntnis, aber
selten so deutlich vorgeführt wie hier.
Neuen Kommentar hinzufügen