|
Die
Goldjungen-Jury, die "Academy of Motion Picture
Arts and Sciences", machte es sich dieses Jahr ziemlich
einfach.
Nominiert wurden zwar kontroverse Filme, doch die Wahl
traf dann
auf die eher gefälligen Vertreter. So erhielt der
umstrittene
"Brokeback
Mountain"
zwar einen  Regie-Oscar,
wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste
dafür
das weitaus unstrittigere Drama "L.A.
Crash" ein. Ebenso verhielt es sich bei den
fremdsprachigen
Filmen: Statt dem favorisierten palästinensischen Beitrag
"Paradise
Now entschied man sich für den im Verhältnis
unverfänglicheren
Beitrag aus Südafrika. Das heißt nicht, dass "Tsotsi"
ein schlechter Film ist, aber trotzdem handelte es sich
bei dieser
Oscarisierung doch um eine politische, weil beabsichtigt
unpolitische
Entscheidung. Regie-Oscar,
wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste
dafür
das weitaus unstrittigere Drama "L.A.
Crash" ein. Ebenso verhielt es sich bei den
fremdsprachigen
Filmen: Statt dem favorisierten palästinensischen Beitrag
"Paradise
Now entschied man sich für den im Verhältnis
unverfänglicheren
Beitrag aus Südafrika. Das heißt nicht, dass "Tsotsi"
ein schlechter Film ist, aber trotzdem handelte es sich
bei dieser
Oscarisierung doch um eine politische, weil beabsichtigt
unpolitische
Entscheidung.
Der 19-jährige Tsotsi (Presley Chweneyagae) ist ein
gefürchteter
Gangster in seinem Viertel am Rand von Johannesburg, der
sich weder
Gedanken um die Vergangenheit noch um die Zukunft machen
will. Eines
Tages schießt er eine Frau an, um ihr Auto zu stehlen.
Doch
während seiner Flucht bemerkt er, dass auf dem Rücksitz
ein Baby liegt. Tsotsi entschließt sich spontan, den
Säugling
zu behalten, und will ihn in seiner Hütte mit Dosenmilch
aufziehen.
Da er jedoch weder stillen noch Windeln wechseln kann,
zwingt er
eine junge Mutter (Terry Pheto) aus dem Township mit
Waffengewalt
dazu, "seinem" Kind die Brust zu geben. Derweil ist ihm
die Polizei schon auf den Fersen, während Tsotsis
Gangsterbande
auseinander bricht.
 "Tsotsi"
ist nach "Drum" und "U-Carmen"
schon der dritte südafrikanische Film, der innerhalb
kurzer
Zeit international vermarktet wird. War schon der
Opernfilm "U-Carmen"
unkonventionell durch in der Landessprache Xhosa gesungene
Texte,
so geht "Tsotsi" noch darüber hinaus: Hier wird der
Slang der Townships, Tsotsi-Taal (eine Mischung aus
Afrikaans und
lokalen Sprachen wie Zulu, Xhosa, Tawana und Sotho)
verwendet, den
nicht einmal alle Südafrikaner verstehen. Musikalisch ist
es
die Musik der Townships, Kwaito, in der rhythmisch
rezitierte Gesänge
über einen instrumentalen Hintergrund mit starker
Basslinie
gelegt werden, die "Tsotsi" vorwärts drängt
und den manchmal etwas gemächlichen Einstellungen Kraft
und
Tempo gegenüberstellt. "Tsotsi"
ist nach "Drum" und "U-Carmen"
schon der dritte südafrikanische Film, der innerhalb
kurzer
Zeit international vermarktet wird. War schon der
Opernfilm "U-Carmen"
unkonventionell durch in der Landessprache Xhosa gesungene
Texte,
so geht "Tsotsi" noch darüber hinaus: Hier wird der
Slang der Townships, Tsotsi-Taal (eine Mischung aus
Afrikaans und
lokalen Sprachen wie Zulu, Xhosa, Tawana und Sotho)
verwendet, den
nicht einmal alle Südafrikaner verstehen. Musikalisch ist
es
die Musik der Townships, Kwaito, in der rhythmisch
rezitierte Gesänge
über einen instrumentalen Hintergrund mit starker
Basslinie
gelegt werden, die "Tsotsi" vorwärts drängt
und den manchmal etwas gemächlichen Einstellungen Kraft
und
Tempo gegenüberstellt.
Das gleichnamige Originalbuch, auf dem "Tsotsi" basiert,
ist der einzige Roman des südafrikanischen Dramatikers
Athol
Fugard. Der Roman spielt in den 50ern, wurde in den 60ern
geschrieben,
aber erst 1980 veröffentlicht. Für den Film wiederum wurde
die Handlung in die jetzige Zeit gelegt. Der weiße Autor
beschäftigte
sich in seinen Theaterstücken mit der Apartheid in
Südafrika,
wodurch ihm die Regierung 1961 sogar seinen Pass für vier
Jahre
entzog.
Der Film "Tsotsi" ist eher farbenblind, da die Gräben
zwischen menschlichen Gruppen hier nicht entlang der
Hautfarbe,
sondern entlang der Armutsgrenze gezogen werden. Das
Ehepaar, dessen
Kind gestohlen wird, ist ebenso schwarz wie die Armen im
Township,
hat es aber zu finanziellem Status gebracht, der mit hohen
Zäunen
vor der Masse geschützt wird. Es gibt nur einen weißen
Charakter im gesamten Film, einen Polizisten, der nett und
freundlich
ist. Die Einführung eines "Quotenweißen" kann
belächelt werden, hat aber wenig  mit
dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht
der weiße
Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in
diversen
Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird
das
Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,
dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,
die aber
nicht mit Namen genannt wird. mit
dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht
der weiße
Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in
diversen
Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird
das
Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,
dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,
die aber
nicht mit Namen genannt wird.
Tsotsi selbst hat eigentlich keinen Namen, wie gleich am
Anfang
des Films klargestellt wird, da "Tsotsi" in den Townships
einfach nur ein Gangmitglied beziehungsweise einen jungen
Kriminellen
am Rand der Gesellschaft bezeichnet. Obwohl die
Regierungspartei
ANC, der Pan African Congress und das Black Consciousness
Movement
versuchten, diese Jugendgangs in disziplinierte politische
Aktivitäten
zu integrieren, sind bis heute alle am Problem der Tsotsis
gescheitert.
"Tsotsi" wurde untypischerweise in Wide Screen auf 35
mm gedreht, und wirkt daher wie ein großes Epos. Die
Bilder
stechen in ihrer sorgsamen Komposition deutlich hervor.
Die Farb-
und Lichtwahl prägen auch die Charaktere. Während es in
Tsotsis Hütte eher düster ist, spielen die Sonnenstrahlen
in der Hütte der jungen Mutter Miriam auf den bunten
Mobiles
aus Glasscherben, die sie bastelt. Dies ist visuell sehr
effektiv,
rückt den Film aber näher an die Grenze des Kitsch, die
mit Fortschreiten des Films irgendwann leider
überschritten
wird.
Während der Anfang des Films soziale Zustände anprangert,
wandelt sich die Handlung bald zum Erweckungsdrama, in dem
sich
die Läuterung des Protagonisten durch bombastische Klänge
und die biblisch angehauchten, langen Einstellungen
deutlich von
der ersten Hälfte absetzt. Gerade die verklärende
Inszenierung
der Miriam als Madonna ist ein Beispiel für Übereifrigkeit
in der Verwendung von Symbolen, wie man sie eher in einem
italienischen
Papstfilm á la "Johannes
XXIII." erwartet.
 Durchweg
gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood
("A
Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für
"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller
Presley
Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu
unterschätzen,
da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und
Mimik die
Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert. Durchweg
gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood
("A
Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für
"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller
Presley
Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu
unterschätzen,
da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und
Mimik die
Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.
So ist "Tsotsi" ein visuell bestechender, eindrucksvoll
gespielter Film, der mit Klängen und Farben ein Bild von
den
Townships zeichnet, wie wir es bisher nicht gesehen haben.
Obwohl
das Werk mehrfach mit "City of God"
verglichen wurde, haben beide doch sehr unterschiedliche
Ansätze,
wenn es darum geht, die Charaktere in ihrer
tragisch-absurden Situation
zu zeigen. Tsotsis Läuterung durch das Baby, das er
aufnimmt,
und die verklärenden Bilder machen den südafrikanischen
Vertreter eindeutig kitschiger.
Es ist bitter, dass "City of God" keine einzige seiner
vier Oscar-Nominerungen vergolden konnte, doch 2004 war
leider das
Jahr des Herrn der Ringe. Dafür sahnte nun "Tsotsi"
die begehrte Trophäe ab, was mal wieder zeigt: Die
Oscar-Jury
mag es, wenn böse Charaktere am Ende gut sind und alle
glücklich
nach Hause gehen. "Tsotsi" war halt die sichere Wahl:
Ein bisschen harte soziale Realität, aber bloß nicht
zu aufdringlich; schöne Bilder, aber trotzdem "echt"
durch authentische Sprache, Musik und tolle
Laiendarsteller. Das
Leben kann auch schön sein - sogar in den Townships.
|
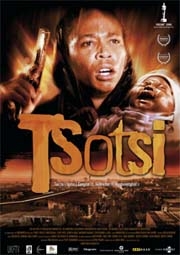
 Regie-Oscar,
wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste
dafür
das weitaus unstrittigere Drama "
Regie-Oscar,
wurde dafür aber nicht bester Film. Diesen Titel heimste
dafür
das weitaus unstrittigere Drama " "Tsotsi"
ist nach "
"Tsotsi"
ist nach " mit
dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht
der weiße
Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in
diversen
Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird
das
Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,
dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,
die aber
nicht mit Namen genannt wird.
mit
dem Leben im Township zu tun, wo Aids und Armut und nicht
der weiße
Teil der Bevölkerung heute eine Rolle spielen. Obwohl in
diversen
Szenen große Werbebanner gegen Aids zu sehen sind, wird
das
Thema jedoch nicht explizit erwähnt. Man erfährt nur,
dass Tsotsis Mutter an einer ansteckenden Krankheit litt,
die aber
nicht mit Namen genannt wird.  Durchweg
gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood
("A
Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für
"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller
Presley
Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu
unterschätzen,
da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und
Mimik die
Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.
Durchweg
gelungen ist hingegen die Besetzung. Regisseur Gavin Hood
("A
Reasonable Man") suchte gezielt nach Laiendarstellern für
"Tsotsi" und fand besonders mit dem Hauptdarsteller
Presley
Chweneyagae ein Juwel. Chweneyagaes Leistung ist nicht zu
unterschätzen,
da er mit wenigen Worten, doch meist nur mit Gestik und
Mimik die
Wandlung Tsotsis glaubwürdig porträtiert.
Neuen Kommentar hinzufügen