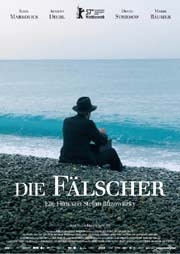
Der Anfang und das Ende von Stefan Ruzowitzkys
neuem Film "Die Fälscher" passen eigentlich gar nicht
in die ernste Geschichte, die er erzählt. Das Bild schimmert
bläulich, die Kamera zeigt in langsamen, fast schon poetischen
Schwenks Aufnahmen vom Meer. Ein Mann wandelt durch ein Casino.
Langsam aber zielstrebig, vorsichtig und doch  irgendwie
sicher. Eine melancholische Mundharmonikamusik begleitet seinen
Schritt, und am Ende, wenn die Kamera den gleichen Mann allein m
Strand in seinem Schlapphut und dunklen eleganten Anzug von hinten
zeigt, ertönt diese traurige Melodie nochmal.
irgendwie
sicher. Eine melancholische Mundharmonikamusik begleitet seinen
Schritt, und am Ende, wenn die Kamera den gleichen Mann allein m
Strand in seinem Schlapphut und dunklen eleganten Anzug von hinten
zeigt, ertönt diese traurige Melodie nochmal.
Der Mann mit dem markanten Gesicht ist Salomon Sorowitsch (Karl
Markovics), und man kann relativ schnell erkennen, dass dieser Mann
ein ganz cleverer Bursche ist. Sorowitsch war vor dem Zweiten Weltkrieg
ein bekannter und von den Behörden gesuchter Geldfälscher.
Nach der Machtergreifung der Nazis und mitten im Krieg wird Sorowitsch
von SS-Offizier Friedrich Herzog (Devid Striesow) gefasst. Sorowitsch
nimmt es erstaunlicherweise sehr gelassen. Schließlich ist
er ein Mensch, der das Leben als Glücksspiel ansieht. Man gewinnt
oder verliert, was anderes gibt es in seinem Weltbild nicht. Als
Jude wird Sorowitsch deportiert und kommt über Umwege von Auschwitz
nach Sachsenhausen. Im KZ gibt es ein Wiedersehen mit Offizier Herzog,
der hier die Aufsicht über eine ganz besondere Gruppe von Häftlingen
hat. Die sollen nämlich abgeschirmt von allen weiteren KZ-Insassen
für die Nazis Geld fälschen. Zunächst britische Pfund
und schließlich auch den als fälschungsresistent geltenden
amerikanischen Dollar. Der talentierte Sorowitsch wird zum Leiter
der Mission ernannt.
 Was
sich hier zunächst wie ein abstruser und vor allem schlechter
Witz anhört, beruht auf wahren Begebenheiten. Um genau zu sein
auf den Erinnerungen von Adolf Burger, die er in seinem Buch "Des
Teufels Werkstatt" veröffentlichte. Das Buch schildert
die unfassbaren Tatsachen rund um das "Unternehmen Bernhard",
gerade jene Geldfälscheraktion der Nazis, für die sie
gut ausgebildete jüdische Drucker benutzten. Ziel der Aktion
war zunächst die Überschwemmung und Destabilisierung der
alliierten Geldwirtschaft. Aber mit dem Verkauf der gefälschten
Geldnoten sollte auch die Kriegskasse aufgestockt werden. Die Häftlinge,
die in der Fälscherwerkstatt arbeiteten, waren von den anderen
völlig abgeschottet und genossen große Freiheiten. Sie
hatten mehr Essen und Trinken, bessere Schlaf- und Waschbedingungen
und auch Freizeit, in der sie zum Beispiel Tischtennis spielen konnten.
Und genau das macht den Reiz des Films aus. Man reibt sich verwundert
die Augen, wenn man den Tagesablauf bei den Fälschern betrachtet.
Sie tragen keine übliche KZ-Kleidung und haben genügend
Zigaretten. Doch alle wissen, dass diese Situation klar terminiert
ist. Wenn sie es schaffen alles zu fälschen, dann sind sie
für die Nazis nicht mehr von Nutzen. Sie waren, wie Adolf Berger
es treffend formuliert hat, Tote auf Urlaub.
Was
sich hier zunächst wie ein abstruser und vor allem schlechter
Witz anhört, beruht auf wahren Begebenheiten. Um genau zu sein
auf den Erinnerungen von Adolf Burger, die er in seinem Buch "Des
Teufels Werkstatt" veröffentlichte. Das Buch schildert
die unfassbaren Tatsachen rund um das "Unternehmen Bernhard",
gerade jene Geldfälscheraktion der Nazis, für die sie
gut ausgebildete jüdische Drucker benutzten. Ziel der Aktion
war zunächst die Überschwemmung und Destabilisierung der
alliierten Geldwirtschaft. Aber mit dem Verkauf der gefälschten
Geldnoten sollte auch die Kriegskasse aufgestockt werden. Die Häftlinge,
die in der Fälscherwerkstatt arbeiteten, waren von den anderen
völlig abgeschottet und genossen große Freiheiten. Sie
hatten mehr Essen und Trinken, bessere Schlaf- und Waschbedingungen
und auch Freizeit, in der sie zum Beispiel Tischtennis spielen konnten.
Und genau das macht den Reiz des Films aus. Man reibt sich verwundert
die Augen, wenn man den Tagesablauf bei den Fälschern betrachtet.
Sie tragen keine übliche KZ-Kleidung und haben genügend
Zigaretten. Doch alle wissen, dass diese Situation klar terminiert
ist. Wenn sie es schaffen alles zu fälschen, dann sind sie
für die Nazis nicht mehr von Nutzen. Sie waren, wie Adolf Berger
es treffend formuliert hat, Tote auf Urlaub.
Ruzowitzky stellt zwei Konflikte in den Vordergrund seiner Geschichte.
Da wäre die Konstellation Sorowitsch und Friedrich Herzog.
Seltsamerweise scheint diese beiden grundverschiedenen Personen
doch etwas zu verbinden. Herzog ist fasziniert von Sorowitschs
Talent und weiß von seinen Fähigkeiten, Sorowitsch wiederum
tut diese Anerkennung seiner Arbeit unheimlich gut.  Er
scheint die Umstände zu vergessen, in denen
er lebt, und konzentriert sich mit seiner ihm so eigenen Ruhe einzig
und allein auf die Aufgabe, den Dollar zu fälschen. Er macht
es nicht für die Nazis, Sorowitsch ist ein egoistischer Mensch,
er macht dies nur für sich: Die scheinbar unmögliche Aufgabe
packt ihn bei seinem Ehrgeiz. Jeder ist sich selbst der Nächste.
Er
scheint die Umstände zu vergessen, in denen
er lebt, und konzentriert sich mit seiner ihm so eigenen Ruhe einzig
und allein auf die Aufgabe, den Dollar zu fälschen. Er macht
es nicht für die Nazis, Sorowitsch ist ein egoistischer Mensch,
er macht dies nur für sich: Die scheinbar unmögliche Aufgabe
packt ihn bei seinem Ehrgeiz. Jeder ist sich selbst der Nächste.
Doch der egoistische Ehrgeiz bringt ihn im KZ nicht weit. Sehr bald
kommt es zu einem sehr intensiven Konflikt zwischen ihm und einigen
Mitarbeitern. Die wollen den Prozess des Fälschens so lange
wie möglich herauszögern, um ihr eigenes Leben zu retten.
Aber wenn eine Sabotage - wie sie Adolf Burger (August Diehl) präferiert
- auffliegen sollte, wäre dies gleichzusetzen mit dem sofortigen
Tod von allen. Ein Dilemma, dass sich immer wieder in riskanten
Aktionen und auch hitzigen Streitigkeiten widerspiegelt.
Man könnte Stefan Ruzowitzky vorwerfen, dass er oft mit den
gängigen Holocaust-Spielfilm-Klischees arbeitet, aber das ist
zum einen nicht wesentlich und ist zum anderen aufgrund des heiklen
Themas verständlich. Es wäre sicherlich ein sehr mutiger
Schritt gewesen, diese Geschichte als eine Art Schlitzohr-Film anzulegen,
also über einen Mann zu erzählen, der auf seine Weise
das Leben meistert und immer wieder gewinnt, auch während des
Zweiten Weltkrieges. Diese Konsequenz fehlt zwar, aber einige gelungene
Elemente davon finden sich dennoch.
Karl Markovics ist einfach grandios in seiner Rolle, und selbst
die Antipode Devid Striesow (man wird ihn dieses Jahr noch in Christian
Petzolds neuem Film "Yella" an der Seite von Nina Hoss
sehen können) kann als Nazi-Offizier überzeugen. Die weiteren
Nebendarsteller von August Diehl ("23") über Sebastian
Urzendowsky ("Ping Pong")
bis hin zu Andreas Schmidt ("Sommer
vorm Balkon") spielen ebenfalls überzeugend und richtig
gut. Dem österreichischen Regisseur gelingt es immer  wieder
mit rein filmischen Mitteln, die Angst der Fälscher zu inszenieren.
Wenn zum Beispiel hinter dem abgeschirmten Teil der Baracken, die
zur Operation Bernhard gehörten, eines ruhigen Abends eine
Exekution nur zu hören ist und eine Kugel zufällig den
Zaun durchbohrt, dann wird allen wieder klar, dass dieser "goldene
Käfig" in dem sie leben müssen, an einem seidenen
Faden hängt und dass auf der anderen Seite des Zauns andere
Zustände herrschen.
wieder
mit rein filmischen Mitteln, die Angst der Fälscher zu inszenieren.
Wenn zum Beispiel hinter dem abgeschirmten Teil der Baracken, die
zur Operation Bernhard gehörten, eines ruhigen Abends eine
Exekution nur zu hören ist und eine Kugel zufällig den
Zaun durchbohrt, dann wird allen wieder klar, dass dieser "goldene
Käfig" in dem sie leben müssen, an einem seidenen
Faden hängt und dass auf der anderen Seite des Zauns andere
Zustände herrschen.
Der Film hält so gekonnt den Spagat zwischen Komödie,
Holocaustdrama und dem Fälscherplot. In dieser Hinsicht ist
das Projekt gelungen. Mit einem wirklich herausragenden Hauptdarsteller
führt uns Ruzowitzky eine besonders perfide Operation der Nazis
erstmals vor Augen oder ruft sie wieder in Erinnerung. In Kombination
mit dem aufrüttelnden Buch von Adolf Bauer schafft der Film
eine historische Aufklärung, wie man sie sich nur wünschen
kann.
Aber wie kann man das Gefühl, die emotionale Regung der Überlebenden
der "Operation Bernhard" auf die große Leinwand
bannen? Vielleicht so, wie es dieser Salomon Sorowitsch im Casino
am Ende des Films in Monte Carlo macht. Er setzt beim Roulette viel
Geld und verliert. Dann sieht man für einen Bruchteil, wirklich
nur für einen Bruchteil einer Sekunde in Karl Markovics' Gesicht
etwas, das man wohl nur mit enormer Erleichterung beschreiben kann.
Neuen Kommentar hinzufügen