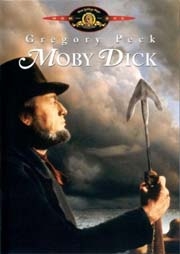
Man sagt, was den Urlaub angehe, gebe es grundsätzlich nur zwei Arten von Menschen: Die einen fahren immer wieder in die Berge oder irgendwohin, wo sie ihre sportlichen Ambitionen beim Wandern, Bergsteigen, Klettern, Elefantenreiten, Rucksacktrampen, Marathonshopping oder mit tagelangen Busfahrten durch den Dschungel befriedigen können; die anderen zieht es Jahr ums Jahr ans oder aufs Meer, weil sie nur dort (sofern sie nicht zwei Wochen in der prallen Sonne durchbraten wollen) jene Weite finden, ohne die sie auf Dauer glauben, nur schlecht oder kaum leben zu können.
John Huston, der Regisseur von "Moby Dick", muss wohl dem zweiten Typ angehören - jedenfalls eröffnet sein Film uns immer wieder ein so grandioses Panorama auf die See und einen so tiefen Einblick in die Sehnsucht derer, die sich wie magisch von ihr angezogen fühlen, dass man sich der Faszination  des unendlichen Horizonts, des wiegenden Schaukelns der Schiffe und der ehrfurchtgebietenden Naturerfahrung kaum entziehen kann. Huston hatte mit Melvilles "Moby-Dick, oder: Der Wal" von 1851 aber auch eine Buchvorlage, die gemeinhin als unverfilmbar galt, eben weil ihre Perspektive so weit ist (und weil keine einzige wirkliche Frauenrolle vorkommt, was für Hollywood eher noch schlimmer war). Darüber hinaus zeichnet uns Hustons "Moby Dick" mit seinen wie in Stein gehauenen Figuren nicht weniger als ein gewaltiges Drama der menschlichen Existenz - der weltberühmte Plot im Vordergrund ist dafür nicht viel mehr als der Aufhänger.
des unendlichen Horizonts, des wiegenden Schaukelns der Schiffe und der ehrfurchtgebietenden Naturerfahrung kaum entziehen kann. Huston hatte mit Melvilles "Moby-Dick, oder: Der Wal" von 1851 aber auch eine Buchvorlage, die gemeinhin als unverfilmbar galt, eben weil ihre Perspektive so weit ist (und weil keine einzige wirkliche Frauenrolle vorkommt, was für Hollywood eher noch schlimmer war). Darüber hinaus zeichnet uns Hustons "Moby Dick" mit seinen wie in Stein gehauenen Figuren nicht weniger als ein gewaltiges Drama der menschlichen Existenz - der weltberühmte Plot im Vordergrund ist dafür nicht viel mehr als der Aufhänger.
Die Geschichte dürfte eine der bekanntesten überhaupt sein: Das Walfangschiff Pequod sticht 1841 vom neuenglischen New Bedford aus in See, unter dem Befehl des von Rachegelüsten getriebenen Kapitäns Ahab (Gregory Peck), und mit den Freunden Ismael (Richard Basehart, der Erzähler) und Queequeg (Friedrich von Ledebur als idealtypischer "edler Wilder") an Bord. Ahab missachtet seinen Auftrag, möglichst reibungslos möglichst viele Wale zu erlegen, um das aufstrebende Amerika mit Öl und Tran für seine Lampen zu versorgen. Stattdessen trachtet er Moby Dick nach dem Leben, einem riesigen weißen Pottwal, der ihm vor Jahren das linke Bein weggerissen und ihn so zum Krüppel gemacht hat.
Einmal aufgespürt, zeigt Moby Dick jedoch, dass alles menschliche Streben ihm wenig anhaben kann: Die ganze Besatzung bis auf Ismael kommt um; die Pequod versinkt, vom Wal gerammt, jämmerlich im Südpazifik. - "Moby Dick" ist damit der direkte Vorläufer von Steven Spielbergs "Weißem Hai", denn das  tiefe Unbehagen am Meer wird hier wohl zum ersten Mal greifbar inszeniert. Allerdings ist der Wal 1956 keineswegs das gefräßige Monster, wie 20 Jahre später sein scharfzahniger Vetter, der um jeden Preis vernichtet werden muss, sondern mehr Werkzeug der unausweichlichen Katastrophe: "Moby Dick" ist viel eher eine Charakterstudie als ein Mega-Action-Trickfilm.
tiefe Unbehagen am Meer wird hier wohl zum ersten Mal greifbar inszeniert. Allerdings ist der Wal 1956 keineswegs das gefräßige Monster, wie 20 Jahre später sein scharfzahniger Vetter, der um jeden Preis vernichtet werden muss, sondern mehr Werkzeug der unausweichlichen Katastrophe: "Moby Dick" ist viel eher eine Charakterstudie als ein Mega-Action-Trickfilm.
Der Film steht mit seiner Aufwändigkeit aber trotzdem auch in einer Reihe mit den anderen großen Produktionen der Traumfabrik aus jenen Jahren, Cecil B. DeMilles "Zehn Geboten" etwa aus demselben Jahr, oder William Wylers "Ben Hur" von 1959. Huston verbrachte Jahre mit dem Projekt - so lange, dass sein Vater Walter, der eigentlich den Ahab spielen sollte, darüber starb und durch Peck ersetzt wurde. Das jedoch erwies sich rein filmtechnisch als Glücksfall: Gregory Peck schauspielert hier wohl auf der Höhe seines Könnens, mit genau dosierter Mimik und Sprachgewalt und doch mit einer Unmittelbarkeit, die direkt unter die Haut geht.
Schon all das setzt John Hustons Meisterwerk an eine sehr prominente Stelle der Filmgeschichte, dürfte aber kaum dazu reichen, "Moby Dick" zu einem der Meilensteine des Kinos zu machen; dazu braucht es mehr, und indem Regisseur und Autoren (Ray Bradbury wurde später selbst mit "Fahrenheit 451" zu einem weltberühmten Schriftsteller) reichlich aus dem tiefen Brunnen der literarischen Vorlage schöpfen, laden sie die Räuberpistole vom Weißen Wal und Kapitän Ahab, die sich gegenseitig verfolgen, mit einer geradezu erschreckenden Wucht auf, die kaum kalt lassen kann.
"Moby Dick" wird oft belächelt als ein klassischer Hollywoodschinken der 50er inklusive gemalter Bühnenkulissen und Pappwal - was er auch ist, daran gibt es nichts zu deuteln. Die Tricks wirken im Zeitalter der Computeranimation bestenfalls amateurhaft, die deutsche Synchronisation ist manchmal mehr als drollig, an Pathos dagegen lässt es Huston in getreuer Nachfolge Melvilles nicht fehlen. Eben  hier aber liegt der Ansatzpunkt: "Moby Dick" will auch viel mehr sein als nur eine Geschichte vom Walfang und von der Rache eines Besessenen. Das zeigt sich schon in der Namengebung - Ahab war auch ein biblischer König, und zwar einer der bösen; Peleg, Bildad (die Eigner des Schiffs), Elias (der den Untergang der Pequod und Ahabs vorhersagt), Ismael sind allesamt Gestalten des Alten Testaments; die biblische Legende von Jonas im Bauch des Wals kommt im Film ebenso zur Sprache wie die Geschichte von der am Himmel festgenagelten Sonne.
hier aber liegt der Ansatzpunkt: "Moby Dick" will auch viel mehr sein als nur eine Geschichte vom Walfang und von der Rache eines Besessenen. Das zeigt sich schon in der Namengebung - Ahab war auch ein biblischer König, und zwar einer der bösen; Peleg, Bildad (die Eigner des Schiffs), Elias (der den Untergang der Pequod und Ahabs vorhersagt), Ismael sind allesamt Gestalten des Alten Testaments; die biblische Legende von Jonas im Bauch des Wals kommt im Film ebenso zur Sprache wie die Geschichte von der am Himmel festgenagelten Sonne.
Überhaupt ist der Bruch denkbar scharf zwischen dem gottesfürchtig-puritanischen Leben der neuenglischen Quäker an Land, dessen Hauptvertreter die Schiffseigner Peleg und Bildad sind, und der Atmosphäre von Auflehnung, Herausforderung, Verzweiflung, Überheblichkeit, Depression und schließlichem Untergang an Bord der Pequod. Starbuck (Leo Genn), der Erste Offizier und besonnene, tiefgläubige Christ, den Ahabs Rachepläne erst beunruhigen, dann anwidern und schließlich anstecken, verklammert diese beiden gegensätzlichen Welten in seiner Person. Dabei hat aber der Kapitän die Mannschaft auf seiner Seite, denn Ahab ist nicht nur verwundet an Körper und Seele, sondern auch (deswegen?) ein charismatischer Führer. Seinem Bass kann sich niemand entziehen, seine Lockungen und Beschwörungen fesseln auch die sonst so nüchternen Seefahrer stets aufs Neue.
John Huston hat bei alldem die klassischen Regeln der Spannungserzeugung gut verinnerlicht: Bis Ahab nicht nur akustisch und in den dunklen Erzählungen der Seeleute, sondern auch visuell auftritt, vergehen mehr als 30 Minuten, und der von ihm so furchtbar gehasste Wal ("ein riesiger marmorner Grabstein") kommt sogar erst rund anderthalb Stunden nach Start ins Bild. Zuvor wird der Untergang fein  und unerbittlich vorbereitet, mit einer Eröffnung an Land - der große Orson Welles als Father Mapple legt das theologische Fundament - und dem Auslaufen des Schiffs auf die große Fläche des Ozeans, der noch unübersehbare Zuspitzungen für die Pequod und ihre Besatzung bereithält.
und unerbittlich vorbereitet, mit einer Eröffnung an Land - der große Orson Welles als Father Mapple legt das theologische Fundament - und dem Auslaufen des Schiffs auf die große Fläche des Ozeans, der noch unübersehbare Zuspitzungen für die Pequod und ihre Besatzung bereithält.
Dieser Ahab nun ist eine ebenso unerhörte Kreatur wie Moby Dick selbst und natürlich die Hauptfigur des Werks. Der Wal ist nicht mehr als ein Instrument - Mittel zur Zerstörung des anmaßenden Kapitäns und zuvor Projektionsfläche seines verzweifelten Hasses. Dabei ist Ahab kein Gottloser. In seinen Monologen, die er aus dem narbenzerfurchten Gesicht mit verzerrtem Mund hervorpresst, ruft er immer wieder Gott an - nicht zuletzt, um die aberwitzige Jagd auf den Riesensäuger zu rechtfertigen: "Gottes Zorn soll uns alle treffen, wenn wir nicht Moby Dick jagen bis in seinen Tod." Und als Starbuck sich endlich halbwegs zum Handeln durchgerungen hat und drauf und dran ist, ihm sein Kommando zu entziehen, speit er ihm entgegen: "Merken Sie sich eins: Es gibt nur einen Gott, der die Welt regiert, und nur einen Kapitän, der hier befiehlt!" So spricht kein Wahnsinniger, der die gesamte überkommene Ordnung aus den Fugen heben will. So spricht vielmehr einer, der all das, was diese Ordnung ihm zur Verfügung gestellt hat - Schiff, Besatzung, Zeit, Geld und Befehlsgewalt -, für eine unheilige Mission einzusetzen gedenkt. Er weiß Starbucks Worte schon ganz richtig einzuordnen, als dieser ihn warnt, mit der Abkehr von der gottgefälligen, weil gemeinnützigen Tran-Fabrikation beschwöre er den Zorn Gottes auf die Pequod herab; wahrscheinlich stimmt er ihnen sogar zu. Und doch will er, kann er nicht anders. "Ist Ahab Ahab?" - solche wissenden und zugleich schrecklich unwissenden Fragen stellt er sich in seinen Grübeleien, weil er erkannt hat, dass er Treibender und Getriebener ist, Subjekt und Objekt der Katastrophe, in die er sich immer tiefer verstrickt. Kapitän Ahab ist mit seinem zweiflerischen Fragen schon ganz in der Moderne angekommen, anders als seine Schicksalsgenossen auf demselben Schiff.
 Das ist die Tragik, die Ahab ins Gesicht geschrieben steht: Zu wissen, dass er sich gleich zweifach gegen das Schicksal auflehnt (durch die Vernachlässigung seiner Pflicht und durch das Aufbegehren gegen das eigene Geschick), und dennoch sich weiter auflehnen zu müssen. Das mündet zwangsläufig im Hader mit Gott, mit dem, der das ganze Welttheater in Gang hält und der seinen Geschöpfen das ewige Fressen und Gefressenwerden verordnet hat. Moby Dick avanciert für Ahab zur Maske des absolut Bösen und doch Gottgegebenen, zum Bild all dessen, was die Menschen seit Urzeiten quält, sie ins Unglück stürzt, gegeneinander aufhetzt und was uns als Krone der Schöpfung zu eigentlich entsetzlich erbarmungswürdigen Wesen macht. Ahab hegt ein zutiefst pessimistisches Weltbild, dem nur die persönliche Rache Sinn verleihen kann, auch wenn darüber das eigene Seelenheil zugrunde geht.
Das ist die Tragik, die Ahab ins Gesicht geschrieben steht: Zu wissen, dass er sich gleich zweifach gegen das Schicksal auflehnt (durch die Vernachlässigung seiner Pflicht und durch das Aufbegehren gegen das eigene Geschick), und dennoch sich weiter auflehnen zu müssen. Das mündet zwangsläufig im Hader mit Gott, mit dem, der das ganze Welttheater in Gang hält und der seinen Geschöpfen das ewige Fressen und Gefressenwerden verordnet hat. Moby Dick avanciert für Ahab zur Maske des absolut Bösen und doch Gottgegebenen, zum Bild all dessen, was die Menschen seit Urzeiten quält, sie ins Unglück stürzt, gegeneinander aufhetzt und was uns als Krone der Schöpfung zu eigentlich entsetzlich erbarmungswürdigen Wesen macht. Ahab hegt ein zutiefst pessimistisches Weltbild, dem nur die persönliche Rache Sinn verleihen kann, auch wenn darüber das eigene Seelenheil zugrunde geht.
Die erschreckende Sonderlichkeit des Befehlshabers der Pequod zeigt sich erst in der zufälligen Begegnung mit zwei Kollegen auf hoher See. Während Kapitän Boomer, ein saufender, plappernder, fröhlicher Londoner, schnell das Weite sucht, als er Ahabs blasphemische Entschlossenheit bemerkt, erkennt Kapitän Gardiner, gleichfalls aus New Bedford, Ahabs Frevel, als dieser ihm Hilfe bei der Suche nach Gardiners Sohn verweigert, der von Moby Dick verschlungen worden ist. Aber Ahabs Kurs steht fest - "ich würde sogar die Sonne angreifen, wenn sie mir etwas zuleide täte."
Wer sich derart gegen die Natur erhebt, muss zerstört werden, zerstört sich selbst - und wie es kommen muss, so kommt es schließlich auch. Ahab reißt die ganze Mannschaft mit ins Verderben, bis auf den einen, der übrig bleibt, davon zu erzählen, und der am Ende, als Schiff und Wal und alle Kameraden verschwunden sind, als Waise auf dem Meer treibt und ausgerechnet von einem Sarg über Wasser gehalten wird - bis ihn gerade Kapitän Gardiners Schiff aufliest.
Wem das alles zu hoch ist, wer mit großen Tieren, rachedurstigen Kapitänen, frommen Offizieren und göttlichem Verhängnis nicht viel anfangen mag, der erinnere sich an seinen letzten Urlaub am Meer. Kennen wir beim Blick auf die See nicht alle die verwirrende Mischung aus dem Glück des obersten Ausgucks der Pequod, dem das Meer und scheinbar die ganze Welt zu Füßen liegen (James Cameron lässt grüßen!), und der unendlichen Traurigkeit jener Einwohner von New Bedford, die das Auslaufen der Pequod nicht mit patriotischem Hurrageschrei, sondern mit tiefem Schmerz verfolgen? Es ist dies der anrührendste Moment eines an großen Emotionen wahrlich nicht armen Films: zu sehen, wie sich die Zurückbleibenden still in ihr Schicksal fügen, während Ahabs Schiff zu seiner unheilvollen letzten Fahrt aufbricht, die eben dieses Schicksal herausfordert.
Wer also das unbestimmte Gefühl der befreiten Beklemmung nachvollziehen kann, wenn er am Meer steht, dem hat "Moby Dick", dieses Drama des heutigen Menschen, eine Menge zu sagen - darüber, dass der feste Boden, auf dem wir stehen, bloß ein Viertel dieses Planeten ausmacht; darüber, dass man sich in diesem gewaltigen Spiegel des Ozeans stets neu selbst entdecken kann; darüber, dass wir alle Ahabs sind, die sich auflehnen gegen das Unvermeidliche, unter welcher Maske es auch daherkommt; darüber schließlich, dass wir mit all unserem großartigen Wissen letztlich genauso hilflos sind wie der auf dem Sarg treibende Ismael nach dem Untergang der Pequod, mit nichts als einer Wüste aus Wasser um sich herum. Packender, ergreifender, besser als in dieser mächtigen Hymne auf das Meer ist unser aller Zerrissenheit zwischen optimistischer, moderner Begeisterung über unsere Fähigkeiten und tiefer, ebenso moderner Skepsis über unsere demütigende Unzulänglichkeit nie umgesetzt worden. "Moby Dick" - großes Kino in jeder Hinsicht, ein epochales Epos vom Ozean, vor allem aber ein beunruhigender Blick in unsere Seele.
Neuen Kommentar hinzufügen