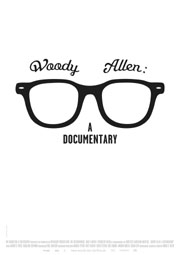
Bilder von Manhattan und Musik von einer Jazz-Klarinette. Wie sollte ein Film über Woody Allen auch anders anfangen als mit der Stadt, die Allen verkörpert wie kaum ein zweiter Filmemacher, und der Musik, die er so sehr liebt, dass er deswegen sogar die Oscar-Verleihung schwänzte, die der erste große Triumph seiner Karriere war.
 Man merkt Robert B. Weides Dokumentation über das Leben und Schaffen von Woody Allen von den ersten Momenten an, dass sie den unverwechselbaren und eigenwilligen Geist eines der größten amerikanischen Film-Autoren der letzten 40 Jahre mehr als verinnerlicht hat. Man merkt „Woody Allen: A Documentary“ aber leider auch an, dass dieser Film von einem bedingungslosen Fan stammt, der vor lauter Ehrerbietung die sich bietende Chance verpasst, wirklich erhellende Einsichten ins Wesen und Wirken von Woody Allen zu vermitteln.
Man merkt Robert B. Weides Dokumentation über das Leben und Schaffen von Woody Allen von den ersten Momenten an, dass sie den unverwechselbaren und eigenwilligen Geist eines der größten amerikanischen Film-Autoren der letzten 40 Jahre mehr als verinnerlicht hat. Man merkt „Woody Allen: A Documentary“ aber leider auch an, dass dieser Film von einem bedingungslosen Fan stammt, der vor lauter Ehrerbietung die sich bietende Chance verpasst, wirklich erhellende Einsichten ins Wesen und Wirken von Woody Allen zu vermitteln.
Weides Film erzählt sauber chronologisch die Lebens- und Schaffensgeschichte des als Allan Stewart Konigsberg geborenen Komikers, beginnend mit seiner Kindheit in einem konservativen jüdischen Elternhaus, das von seinen Showbusiness-Ambitionen überhaupt nichts hielt, über seine Anfänge als Gag-Schreiber für New Yorker Zeitungskolumnisten hin zu seinem Durchbruch als quasi erster landesweiter Star der Stand-Up-Comedy-Szene. Ein früher Ruhm, der zu Allens erstem Drehbuch-Auftrag führte – eine bittere Erfahrung, denn das Studio zerfledderte und verdrehte sein Skript auf dem Weg zum fertigen Film so sehr, dass Allen sich schwor, nie wieder einen Film zu machen, bei dem er nicht selbst die vollständige kreative Kontrolle hatte.
 Gesagt, getan, und der Rest ist ein kleines Stück Filmgeschichte. Allen fand eine einfache Produktionslogik – ich drehe einen Film so preiswert, dass er trotz überschaubarem Publikumserfolg immer noch einen kleinen Profit bringt, dann werde ich auch das Budget für den nächsten Film bekommen – die bis heute funktioniert und es ihm erlaubt, seit den frühen 70ern mit bestechender Regelmäßigkeit fast jedes Jahr einen neuen Film herauszubringen.
Gesagt, getan, und der Rest ist ein kleines Stück Filmgeschichte. Allen fand eine einfache Produktionslogik – ich drehe einen Film so preiswert, dass er trotz überschaubarem Publikumserfolg immer noch einen kleinen Profit bringt, dann werde ich auch das Budget für den nächsten Film bekommen – die bis heute funktioniert und es ihm erlaubt, seit den frühen 70ern mit bestechender Regelmäßigkeit fast jedes Jahr einen neuen Film herauszubringen.
Entsprechend viel Terrain hat „Woody Allen: A Documentary“ abzudecken, kann viele von Allens Filmen darum naturgemäß nur streifen und lässt einige seiner weniger bemerkenswerten Werke sogar ganz außen vor. Die wichtigsten Meilensteine finden aber ihre ausreichende Würdigung: Allens frühe Phase mit seinen reinen Farce-Komödien; sein bahnbrechendes erstes Meisterwerk „Der Stadtneurotiker“ („The bomb that would change comedies forever“ wie es einer der vielen hier interviewten Weggefährten auf den Punkt bringt); der phänomenale Erfolg von Allens bis heute meistgeliebtem Film „Manhattan“ und der kurz darauf folgende, allgemeine Total-Verriss seines sehr introvertierten „Stardust Memories“. Dies ist denn auch eine der vielen Stellen, wo Allens ganz eigene Mentalität durchscheint, gesteht er doch sowohl, dass er „Manhattan“ nach Fertigstellung so misslungen fand, dass er ihn am liebsten nie herausgebracht hätte, als auch dass der allseits gehasste „Stardust Memories“ zu seinen persönlichen Favoriten zählt.
 In diesem und vielen ähnlichen Momenten zeigt Weides Film Woody Allen, wie ihn jeder Filmliebhaber kennt: Von ewigen Selbstzweifeln getrieben, sich selbst und seine Leistung immer wieder klein redend, mit der eigenen Unzulänglichkeit kokettierend, dass man es einfach charmant finden muss. „I don’t have the concentration or dedication to be a great artist. I’d rather go home and watch a Baseball game” bekennt Allen an einer Stelle, und man denkt sich liebevoll: Hach, typisch Woody.
In diesem und vielen ähnlichen Momenten zeigt Weides Film Woody Allen, wie ihn jeder Filmliebhaber kennt: Von ewigen Selbstzweifeln getrieben, sich selbst und seine Leistung immer wieder klein redend, mit der eigenen Unzulänglichkeit kokettierend, dass man es einfach charmant finden muss. „I don’t have the concentration or dedication to be a great artist. I’d rather go home and watch a Baseball game” bekennt Allen an einer Stelle, und man denkt sich liebevoll: Hach, typisch Woody.
Was Weides Film nicht schafft – und darum bleibt er letztlich ein oberflächliches, zu keinem Zeitpunkt wirklich erhellendes Werk – ist es, irgendeinen Eindruck von Allen zu vermitteln, der über dieses bestens bekannte Bild hinaus geht. Obwohl Weide seinen Protagonisten über zwei Jahre lang begleitete und die Dreharbeiten von zwei Allen-Filmen („Ich sehe den Mann deiner Träume“ und „Midnight in Paris“) miterlebte, erhält man in dieser Dokumentation erstaunlich wenige Einblicke in Allens Arbeitsprozess, abgesehen von ein paar wenigen amüsanten Szenen, in der Allen – wiederum typisch liebenswert-tapsig – die äußerst altmodische Zettelwirtschaft seines Schreibprozesses offenbart.
 Ähnlich oberflächlich und mit merklicher Zurückhaltung streift Weide auch nur ziemlich kurz die unangenehmste Phase von Woodys Karriere, den hässlichen Scheidungskrieg mit Mia Farrow, nachdem Allens Affäre mit der gemeinsamen Adoptivtochter ans Licht gekommen war. Chronistenpflicht schnell abgehakt, dann flugs weiter zu Allens kreativer Wiederauferstehung nach längerer Durststrecke mit seinen „Europa-Filmen“, angefangen mit „Match Point“ und (bis dato) besiegelt mit „Midnight in Paris“, der kommerziell erfolgreichste Film aus Allens Karriere. Man gewinnt fast den Eindruck, als wäre Weide dieses etwas peinliche Kapitel aus Allens Leben selbst ein wenig unangenehm, und er kommt lieber schnell zum nächsten Punkt, anstatt Allen „unsensibel“ eine direkte Frage dazu zu stellen.
Ähnlich oberflächlich und mit merklicher Zurückhaltung streift Weide auch nur ziemlich kurz die unangenehmste Phase von Woodys Karriere, den hässlichen Scheidungskrieg mit Mia Farrow, nachdem Allens Affäre mit der gemeinsamen Adoptivtochter ans Licht gekommen war. Chronistenpflicht schnell abgehakt, dann flugs weiter zu Allens kreativer Wiederauferstehung nach längerer Durststrecke mit seinen „Europa-Filmen“, angefangen mit „Match Point“ und (bis dato) besiegelt mit „Midnight in Paris“, der kommerziell erfolgreichste Film aus Allens Karriere. Man gewinnt fast den Eindruck, als wäre Weide dieses etwas peinliche Kapitel aus Allens Leben selbst ein wenig unangenehm, und er kommt lieber schnell zum nächsten Punkt, anstatt Allen „unsensibel“ eine direkte Frage dazu zu stellen.
So bleibt „Woody Allen: A Documentary“ eine brave Angelegenheit, die einen kurzweiligen und gut aufbereiteten Marsch einmal quer durch Allens Werk bietet, aber tiefere Einsichten vermissen lässt. Allemal unterhaltsamer und besser aufbereitet als ein Wikipedia-Artikel. Aber genau wie ein solcher für echte Kenner des Themas ohne echten erhellenden Mehrwert.
Neuen Kommentar hinzufügen