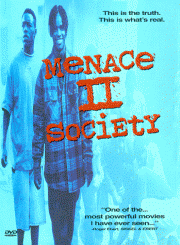
Rassenkonflikte sind nach wie vor eines der größten sozialen Probleme in den USA. Diese Konflikte entstehen vor allem aus den katastrophalen Verhältnissen, in denen die meisten ethnischen Minderheiten im Land leben. Die Schwarzen sind da nur ein Beispiel für, wenn sie auch die größte Minderheit darstellen. Abgegrenzt von den „weißen“ Stadtzentren leben sie in eigenen Ghettos mit wenig bis keinen Aufstiegschancen, und werden so fast zwangsläufig in einen Teufelskreis des Verbrechens hineingerissen, in dem man nicht lange überleben kann.
Lange Zeit wurden diese Verhältnisse unter den Teppich gekehrt, bis ein paar Afro-Amerikaner genug Talent und Einfluß aufbrachten, um medial darauf aufmerksam zu machen. Der erste von ihnen war Spike Lee (siehe Videotip „Jungle Fever“), der der gesamten Welt das Leben der Schwarzen in Amerika vor Augen führte. Als Lee’s Filme anfingen, schlechter zu werden, standen seine Nachfolger bereits parat, mit Filmen, die das Schock- und Realitätspotential von Lee’s Werken noch überflügelten. Den ersten Schritt machte John Singleton’s „Boyz in the Hood“ von 1991 (Singleton ist übrigens nicht nur der jüngste Nominierte für den Regie-Oscar bisher, sondern auch der einzige Schwarze). Während dieser noch einen Ausweg aus dem tiefen Sumpf von South Central, Los Angeles, schilderte, sollte diese „Illusion“ im nächsten großen Werk des „New Black Cinema“ schließlich fallen. 1993 kam „Menace II Society“, das Erstlingswerk der gerade einmal 21-jährigen Zwillinge Allen und Albert Hughes.
Im Zentrum des Films steht Caine (Tyrin Turner). Caine ist in etwa das, was im Distrikt Watts (sozusagen das Ghetto des Ghettos South Central) als stinknormaler Teenie durchgehen würde: Sein Vater war ein Dealer, seine Mutter ein Junkie, beide sind tot. Mit fünf Jahren hat er das erste Mal eine Waffe in der Hand gehalten, mit 17 hat er einen Pieper, einen schicken Wagen und verdingt sich als Schmalspur-Dealer. Er wohnt bei seinen stark religiösen Großeltern, glaubt aber weder an Gott noch an sonst irgend etwas. Ein ganz normaler Teenager in Watts eben. Am Anfang von „Menace II Society“ betritt Caine mit seinem Freund O-Dog (Larenz Tate) einen Gemischtwarenladen, der von einem asiatischen Ehepaar geführt wird. Die Asiaten fürchten sich vor den jungen Schwarzen und wollen sie schnellstmöglich aus dem Laden haben. O-Dog, der eigentlich nur eine Flasche Bier kaufen wollte, merkt das und weidet sich erst einmal an der Angst des kleinen Mannes. Als sie den Laden verlassen wollen, meint der Asiate: „Deine Mutter tut mir leid.“ Und dann ist er tot. Caine kann gar nicht so schnell gucken, da hat O-Dog auch schon das Tape der Sicherheitskamera von der Frau bekommen und diese ebenfalls umgelegt.
Und schon sind wir mitten drin im Kreis der Gewalt. Wer sich noch der Illusion hingibt, daß an manchen Stellen dieser Erde nicht alltäglich Menschen aus völlig nichtigen Gründen von anderen umgebracht werden, der ist im falschen Film. Die Gewalt in „Menace II Society“ kommt genau so, wie sie nunmal ist: Unberechenbar, schnell, schnonungslos, und vor allem ohne Sinn.
Diese erste Szene ist schon unglaublich bezeichnend für die gesellschaftliche Situation, die der Film schildert: Obwohl sie letztendlich alle im gleichen Boot sitzen, sind die Minderheiten in den USA sich gegenseitig der größte Feind. Schwarze hassen Asiaten, Asiaten hassen Schwarze. Und sie wohnen direkt nebeneinander. Die jungen Schwarzen, denen überall eingetrichtert wird, sie seien der soziale Abfall der Nation, suchen auf ihre Art nach ein bißchen „Respekt“. Sie glauben, Furcht sei gleich Respekt, und sie würden nur respektiert werden, wenn sie den Leuten eine Kanone vor die Nase halten. Daß dies überhaupt nichts mit Respekt zu tun hat, merken sie nicht mehr in ihrem verzweifelten Versuch, von irgendjemandem ernst genommen zu werden. „Respektiert“ wird nur der, der am Ende noch steht. Daß am Ende meistens keiner mehr steht, zeigt dieser Film nur zu genau.
Caine ist sicherlich geschockt vom crassen Doppelmord O-Dogs, aber das ist noch lange kein Grund, vom üblichen Verhalten abzuweichen. Zur Sorge seiner Großeltern zieht Caine weiter mit seinen Freunden um die Häuser. Man besäuft sich, kifft ein bißchen, beliefert die Junkies mit Stoff, und um eine Party ein wenig aufzulockern zeigt O-Dog auch mal gerne das Video aus dem Gemischtwarenladen („Peng! Da hab ich ihn erwischt!“). Das sieht alles sehr entspannt aus, ist aber nur ein kurzes Zwischenspiel auf dem Weg zur nächsten Eskalation der Gewalt. Caine’s Cousin wird bei einem Autodiebstahl erschossen, er selbst schwer verletzt, aber kaum ist er aus dem Krankenhaus raus, wird die Racheaktion geplant.
Es ist ein Teufelskreis, der sich immer weiter zieht. Caine weiß selbst, daß er keine Zukunft hat, scheut sich aber dennoch, aus der Gegend wegzuziehen. Denn hier ist er jemand, bekommt „Respekt“ und kennt sich aus. Die Chance, rauszukommen, hat er. Doch Caine zögert, obwohl der Verstand ihm sagt, was richtig ist. Und jeden Tag lauert der Tod an einer anderen Ecke.
Wo sich Singleton in „Boyz in the Hood“ noch relativ zurückhielt, lassen die Hughes-Brüder alle Schranken fallen. Mord ist die häufigste Todesursache bei Schwarzen unter 30? Gut, dann werden wir das auch zeigen! Junge Ghetto-Bewohner fluchen überdurchschnittlich viel? So ist es auch in unserem Film (in einer Szene wird innerhalb von 60 Sekunden ungefähr einhundertmal die Silbe „fuck“ benutzt)! So etwas wie einen unschuldigen Schwarzen gibt es nicht? Stimmt, deshalb ist unser Protagonist auch nicht besser als die anderen.
Der Zuschauer hat es wahrlich nicht leicht: Caine ist an mehreren Morden beteiligt, dealt mit Drogen, klaut Autos, schwängert fremde Mädchen und schlägt deren Cousins brutalst zusammen. Und trotz alledem ist er der Sympathieträger, denn sehr schnell wird klar, was die Hughes-Brüder uns sagen wollen: Caine ist nur das Ergebnis seines Umfelds. Wenn wir dort aufgewachsen wären, würden wir genau so sein. Die Unterschiede zwischen einer völlig abgestumpften und unberechenbaren Gewalt-Maschine wie O-Dog und dem noch ansatzweise moralisch veranlagten Caine sind minimal. Sie wissen genau, in was für einer Scheiße sie sitzen, aber weil sie nichts anderes kennen, haben sie fast Angst davor, diese Scheiße zu verlassen.
„Menace II Society“ ist der bis dato realistischste, schonungsloseste und wohl auch beste „Ghetto-Film“. Dies verdankt er zum einen dem unglaublichen Talent seiner beiden blutjungen Regisseure, zum anderen dem Einsatz der leidenschaftlich arbeitenden Darsteller. Fernab jeder Schönfärberei und pseudo-coolem Getue entlarven sie die verletztlichen Seelen hinter dem harten Homie-Gehabe und bringen Tiefe in Charaktere, die anderswo nur als billige Klischees verbraten werden. Es ist schade, daß so wenige der exellenten Schauspieler den Sprung nach oben geschafft haben. Gerade von Tyrin Turner und dem unglaublichen Larenz Tate hätte man gerne mehr gesehen. Samuel L. Jackson hat einen relativ kurzen Auftritt als Caine’s Vater, und Will-Smith-Gattin Jada Pinkett ist hier in ihrem Filmdebüt zu bewundern.
Die Hughes-Brüder konnten mit ihrem zweiten Film „Dead Presidents“ nicht an das Niveau von „Menace II Society“ anknüpfen, und man wartet weiterhin auf ihren nächsten Erfolg. Dennoch haben sie mit ihrem Erstlingswerk schon mehr bewegt, als es manchen Filmemachern in einem ganzen Leben nicht gelingt. Die unglaubliche Wirkung, die dieser „kleine“ Independent-Film auf sein Publikum hatte, wurde bei den MTV Movie Awards 1993 deutlich. Dort gewann „Menace II Society“ den Preis für den besten Film vor solch illustren Konkurrenten wie „Jurassic Park“ oder „Auf der Flucht“. Ein weiteres Zeichen, daß bei den MTV-Awards manchmal mehr Gerechtigkeit waltet als bei den Oscars.
Neuen Kommentar hinzufügen