|
 Wenn
dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"
in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich
vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit
Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"
von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur
tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten
und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten
Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,
die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke
in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt
Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem
Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,
um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen. Wenn
dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"
in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich
vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit
Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"
von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur
tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten
und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten
Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,
die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke
in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt
Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem
Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,
um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen.
Der nackte Zano (Romain Duris, "Der
wilde Schlag meines Herzens" und "L'auberge
Espanole") dreht sich weg vom Fenster, durch dass man die
uninteressanten und tristen grauen Straßen von Paris erkennen
kann. Er könnte ein paar Stockwerke hinabsteigen und würde
sich dann im Zentrum der Gleichgültigkeit einer Weltmetropole
wiederfinden. Man könnte aber auch ausbrechen und auswandern.
"Lass uns nach Algerien gehen" sagt er plötzlich
und regungslos zu Naïma (Lubna Azabal, "25 Grad im Winter"),
die ebenfalls nackt ist und von der gleichen Emotionslosigkeit beherrscht
wird wie Zano.
 So
unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".
Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,
die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient
und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und
Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass
sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie
sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.
Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,
die ihnen ihre Reise bringen könnte. So
unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".
Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,
die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient
und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und
Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass
sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie
sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.
Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,
die ihnen ihre Reise bringen könnte.
Gatlifs Geniestreich zeichnet einen enorm sehenswerten Culture
Clash und macht aus "Exil" ein schönes Stück
sorgloses und überdrehtes Road-Kino, dass ab und zu von einem
angenehmen Mystifizismus überzogen wird. So wird hier aus dem
biblischen Symbol der Apfelübergabe von Eva an Adam ein Vorspiel
und dann eine bizarre sexuelle Phantasie. Das Zwiegespräch
mit dem Großvater endet mit einem Paar Walkman-Kopfhörer,
die an seinen Grabstein gehängt werden. Und Naïma weigert
sich stur, die traditionelle arabische Kleidung zu tragen nur weil
... nur weil ihr zu heiß ist.
 Das
einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden
scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt
Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller
permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband
oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.
Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,
französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap. Das
einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden
scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt
Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller
permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband
oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.
Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,
französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap.
"Exil" ist ein Anti-Roadmovie, weil Naïma und ihr
Freund gegen den Strom wandern. Sie ziehen nicht wie üblich,
in Richtung der Industrieländer. Nein, sie gehen zurück,
zu den Wurzeln ihrer Identität. Sie begegnen aber immer wieder
Menschen, die dann doch dem Strom der Emmigranten folgen, und die
auf ein besseres Leben hoffen. Ein Leben ohne Armut und ohne Hunger.
Ein Leben, das Zano und seine Freundin hatten, das sie aber aufgeben
um ihre Identitätslosigkeit zu bekämpfen.
 Regisseur
Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist
Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm
der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die
nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten
oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen
tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts
mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.
Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,
wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht
die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe. Regisseur
Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist
Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm
der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die
nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten
oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen
tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts
mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.
Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,
wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht
die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.
Und trotzdem oder genau deshalb bekommt man ein erfischendes Gefühl
von Schönheit vermittelt. Vielleicht weil die Schönheit
hier nicht perfekt ist. Sie trägt Narben: Narben, die der französisch-algerische
Krieg hinterlassen hat. Narben, die beide Liebenden an ihren Körpern
haben und auch die, die sie tief in ihrer Psyche tragen.
Im ganzen Film fällt nicht ein unnützes Wort. Jeder nimmt
von dieser Reise mit, was er bekommen konnte. Im Epilog sitzen unsere
Helden auf dem Friedhof: Naïma schält eine Apfelsine.
Sie sind nicht in Eile. Vielleicht kommen sie einmal wieder zurück,
vielleicht aber auch nicht. Sie müssen es jedenfalls nicht
mehr. Freiheit (und das scheint die universelle Botschaft dieses
Schmuckstückes des jungen französischen Kinos zu sein)
bedeutet, sich niemals irgendwo auf Dauer niederzulassen.
|
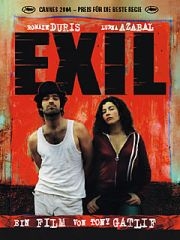
 Wenn
dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"
in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich
vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit
Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"
von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur
tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten
und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten
Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,
die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke
in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt
Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem
Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,
um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen.
Wenn
dieses Jahr Michael Hanekes preisgekrönter Film "Cache"
in die Kinos stürmen wird und man dann unmissverständlich
vor Augen geführt bekommt, wie unaufgearbeitet die Vergangenheit
Frankreichs noch ist, sollte man sich jedoch zuvor "Exil"
von Tony Gatlif ansehen. Denn auch der französische Regisseur
tunesischer Abstammung verarbeitet in seinem bereits 2004 gedrehten
und auch im selben Jahr mit dem Regiepreis in Cannes ausgezeichneten
Werk Frankreichs Vergangenheit auf eine wunderbare Art und Weise,
die der schonungslosen und fast rabiaten Handschrift von Haneke
in nichts nachsteht. In diesem fulminanten Anti-Roadmovie stellt
Gatlif die Frage auf, was mit Immigranten passiert, die mit ihrem
Leben in der neuen Heimat nicht mehr zurecht kommen und aufbrechen,
um nach dem verlorenen Glück in der alten Heimat zu suchen. So
unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".
Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,
die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient
und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und
Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass
sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie
sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.
Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,
die ihnen ihre Reise bringen könnte.
So
unspektakulär und fast phlegmatisch beginnt "Exil".
Beide verlassen die Großstadt, um sich auf eine Reise zu begeben,
die die üblichen back-to-the-roots-Klischees nicht bedient
und weit darüber hinaus zur Meditation über Kultur und
Integration im Allgemeinen wird. Beide werden schnell merken, dass
sie in ihrer Heimat nicht mehr den Anschluss finden werden. Sie
sind aber auch keine Europäer. Sie sind irgendetwas dazwischen.
Hilflos zwischen den Stühlen hoffen sie auf eine Art Erleuchtung,
die ihnen ihre Reise bringen könnte. Das
einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden
scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt
Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller
permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband
oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.
Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,
französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap.
Das
einzige Element, das diese kulturellen Differenzen zu verbinden
scheint, ist die Musik. "Musik ist meine Religion", sagt
Zano einmal. So ist es auch die Musik, die beide Hauptdarsteller
permanent begleitet, ob als wehleidiger Gesang einer Zigeunerband
oder als psychedelischer Elektrobeat aus einer spanischen Kneipe.
Es ist ein schräger Sound. Eine Mischung aus spanischem Flamenco,
französischen Elektro-Upbeats und arabischem Rap. Regisseur
Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist
Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm
der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die
nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten
oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen
tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts
mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.
Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,
wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht
die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.
Regisseur
Gatlif wurde, ähnlich wie sein männlicher Protagonist
Zano, in Algier geboren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ihm
der Weg von Algier nach Paris äußerst vertraut ist. Die
nichtssagenden Gesichter zufällig vorüber gehender Passanten
oder die bei Sonnenuntergang gefilmten europäischen Landstraßen
tragen eine sehr persönliche Handschrift. Diese Reise hat nichts
mit den üblichen National Geographic-Dokumentationen zu tun.
Hier gibt es keine schönen und klaren Bilder. So sieht man,
wenn die Kamera durch die Scheibe eines Zugabteils schaut, nicht
die beeindruckende Landschaft, sondern den Schmutz der Scheibe.
Neuen Kommentar hinzufügen