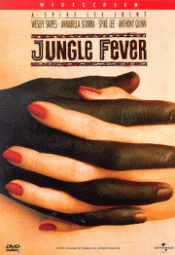
Es gibt kaum einen Regisseur, der für die Repräsentierung der Afro-Amerikaner im Film soviel getan hat wie Spike Lee. Obwohl er anfing mit kleinen Independent-Produktionen und teilweise sehr extreme Standpunkte vertrat, verhalfen ihm seine unbestreitbaren Fähigkeiten als Regisseur und Autor alsbald zu einer enormen Reputation und großen Möglichkeiten. Den Zenit seiner Karriere erreichte Lee schließlich 1991 mit dem Film „Jungle Fever“.
„Jungle Fever“ ist Spike Lee’s Ausdruck für die Anziehungskraft zwischen einem Schwarzen und einer Weißen, die das zentrale Thema dieses Films ist. Opfer des Fiebers ist zum einen Flipper (Wesley Snipes), ein glücklich verheirateter und finanziell erfolgreicher Schwarzer, der morgens vor dem Aufstehen gerne mit seiner Frau schläft, deren unkontrollierte Lustgeräusche für entzückend unschuldige Verwirrung bei der kleinen Tocher sorgen: „Daddy, hast du Mami heute wieder weh getan? Sie sieht schon wieder so glücklich aus!“. Zum anderen wäre da Angie Tucci (Annabelle Sciorra), eine Italo-Amerikanerin, die als Aushilfssekretärin in Flippers Büro anfängt. Wenige Tage später machen die beiden zusammen Überstunden, bestellen chinesisches Essen, und treiben es auf dem Schreibtisch. Von da an steht alles Kopf. Flippers Frau ist schockiert und wirft ihn raus, sein Vater, ein ehrwürdiger Reverend aus Harlem, kann sich kaum entscheiden, was schlimmer ist: der Ehebruch, oder daß es mit einer Weißen war. Und ausgerechnet sein guter Junge Flipper! Flippers Bruder Gator (Samuel L. Jackson) ist das schwarze Schaf der Familie, ein Crack-Junkie, der höchstens nach Hause kommt, um den Fernseher zum Verpfänden mitzunehmen. Aber auch bei Angie herrscht fortan wenig Ruhe. Ihr Verlobter Paulie ist noch nicht mal sonderlich wütend, denn er hat selber ein heimliches Auge auf eine schwarze Schönheit geworfen, die allmorgendlich bei ihm Kaffee und Donut kauft. Weniger begeistert sind hingegen seine latent rassistischen Freunde, die in seinem Coffee Shop abhängen, und sein Vater Lou (Anthony Quinn), der sich nichts weiter wünscht, als eine gute Frau für seinen Sohn. Schnell stehen Angie und Flipper alleine da, und da gehen die Probleme erst los.
Spike Lee schafft es, in „Jungle Fever“ die drei wichtigsten Themen in der afro-amerikanischen Gesellschaft abzuhandeln, ohne daß eines sonderlich zu kurz kommt: Rassismus, Religiösität, und Drogen. Mit unglaublicher Virtuosität und gnadenlosem Realismus hält er dem Land den Spiegel vor und nimmt der Bevölkerung die Worte direkt aus dem Mund. Wie schon in seinem Meisterwerk „Do the right thing“ spielt vor allem der Zusammenprall zweier Kulturen die entscheidende Rolle: Die schwarze und die italienische. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß die Szenen mit Flipper und Angie, ihre Liebe und Leidenschaft, reichlich gestellt und unecht wirken. Das ist nicht Lee’s Territorium, und es ist auch nicht sein Punkt. Viel mehr geht es ihm um die Reaktionen des Umfelds, und die sind wahrlich kongenial eingefangen.
In der besten Szene des Films (die komplett improvisiert wurde) sitzt Flippers Ehefrau mit einigen Freundinnen zusammen, und sie unterhalten sich über die Beweggründe schwarzer Männer. Von purer Verzweiflung über scharfzüngigen Humor bis hin zu Selbstzweifel findet sich hier alles wieder, und innerhalb weniger Minuten bekommt man ein wirklich realistisches Bild darüber, wie schwarze Frauen ihre Männer sehen.
Nicht weniger interessant geht es auf der italienischen Seite zu. Es tut in der Seele weh, den armen Paulie dabei beobachten zu müssen, wie er jeden Morgen der schwarzen Schönheit hinterher schmachtet, aber mit niemandem darüber reden kann, weil all seine Freunde Rassisten sind (obwohl einer von ihnen Paulie wesentlich besser versteht, als dieser vielleicht glaubt).
Für die Aspekte Religion und Drogen muß Flippers Familie herhalten: Sein absolut bibeltreuer Vater mag ein verständnisvoller und angesehener Reverend sein, den Problemen des eigenen Anhangs steht er jedoch macht- und verständnislos gegenüber. Das Absacken seines einen Sohnes in die Drogenhölle versucht er mit Abkoppelung und Verweigerung zu bekämpfen, was selbstverständlich der völlig falsche Ansatz ist, während seine Gattin zu gutmütig ist, um ihrem Sohn etwas auszuschlagen, und ihm gegen besseres Wissen doch jedesmal wieder Geld mitgibt. Die Szenen im Hause der Familie Purify (schon mal was von Telling Names gehört?) erzeugen eine so erdrückende Atmosphäre, daß man unvermittelt ein Fenster aufreißen möchte, aber stattdessen wird man immer mehr in dieses qualvoll dem Abgrund entgegenschleichende Familiendrama hineingezogen. Eine Sequenz, in der Flipper seinen Bruder in einer Crack-Höhle sucht, stellt so ziemlich das eindrucksvollste dar, was je zu diesem Thema gedreht wurde: Es erscheint wirklich wie der innerste Kreis der Hölle.
Es ist fast schon unglaublich, mit welcher Leichtigkeit Lee all dies in seinen Film packt, der sich bei etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit auch dementsprechend rasant fortbewegt und dem Zuschauer kaum eine Erholungspause gönnt. Einen wichtigen Beitrag leisten dazu natürlich die exzellenten Darsteller. Aus beiden dargestellten „ethnischen Minderheiten“ holte sich Lee die (damals teilweise noch unbekannte) Crème de la Crème zusammen: Auf schwarzer Seite Wesley Snipes, Samuel L. Jackson, Ossie Davis, Halle Berry und andere, und auf italienischer Annabelle Sciorra, John Turturro und Anthony Quinn. Die Besetzung stimmt auf jeder Position, die Szenen sind entsprechend stimmig, und bald vergißt man, daß man nur einen Film sieht.
Der einzige Fehler des Films ist, daß er sein eigentliches Thema, das „Jungle Fever“, zu schnell aus den Augen verliert. Sicherlich wird das Hauptaugenmerk korrekterweise auf das Drumherum gerichtet, aber andererseits bleibt die Beziehung zwischen Flipper und Angie doch der zentrale Punkt, und gerade der erscheint am wenigsten plausibel. Zu keinem Zeitpunkt ist die Beziehung wirklich nachvollziehbar und läßt sich nur auf eine kaum erklärbare Anziehungskraft zurückführen. Für diese Kraft hat Spike Lee seine ganz eigene Erklärung, die er oft genug kund tat. Da ich diese aber für falsch und engstirnig halte und sie für den Film auch nicht relevant ist, werde ich sie hier auch nicht wiedergeben.
„Jungle Fever“ ist meiner Meinung nach der kompletteste Film, den Spike Lee gemacht hat. Hier stimmt fast alles, und der Zuschauer findet sich mitten in einer gnadenlos intensiven Geschichte wieder, die die harte Wahrheit auf Amerikas Straßen schonungslos, aber nicht plakativ vor Augen führt. Eine Welt, in der Harmonie nur ein Trugbild ist, und das nächste Stück grausame Realität schon an der nächsten Straßenecke wartet, mit einem günstigen Angebot auf den Lippen.
Neuen Kommentar hinzufügen