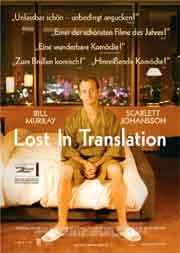
Der erste markante Filmauftritt von Sofia Coppola war alles andere als vielversprechend: Geleitet von überzogenem Familienbewusstsein besetzte sie ihr Vater Francis Ford Coppola für die Rolle von Michael Corleones Tochter im dritten Teil der "Pate"-Saga, wo Sofia in einem Film von ohnehin diskutabler Qualität eine wahrlich unterirdische Schauspielvorstellung ablieferte. Dass sie nach diesem Fiasko der Filmwelt nicht komplett den Rücken zukehrte, dafür muss man retrospektiv allerdings dankbar sein, ebenso wie für Sofias Entscheidung, eher in die Fußstapfen des Herrn Papa zu treten und hinter die Kamera zu wechseln. Denn schon mit ihrem Regiedebüt, dem ätherisch-verschlossenen Teenager-Drama "The Virgin Suicides", sorgte Fräulein Coppola für massives Aufhorchen und wurde unter anderem bei den MTV Movie Awards 1999 als beste Nachwuchs-Filmemacherin ausgezeichnet. Vier Jahre später folgt nun Film Nummer Zwei, der seinen beeindruckenden Vorgänger nochmals zu überflügeln weiß, denn mit "Lost in Translation" erzählt Coppola nicht nur eine gewitzte Komödie, sondern auch die sehr gut beobachtete Geschichte zweier Seelen, die eine Menge gemeinsam haben, obwohl sie gut 20 Jahre trennen.
 Im
noblen Park Hyatt Hotel in Tokio begegnen sich - an der Hotelbar,
wo sonst - die beiden Amerikaner Bob (Bill Murray in der vielleicht
besten Vorstellung seiner Karriere) und Charlotte (Scarlett Johansson,
"Ghost World"). Er ein gemachter Schauspielstar, der für
den Dreh eines lächerlichen Whiskey-Werbespots angereist ist,
sie die junge Gattin eines gefragten Fotografen (Giovanni Ribisi),
der auf seinen Reisen nicht wirklich Verwendung für seine Frau
hat. Bob und Charlotte kommen ins Gespräch, weil sich ihnen
im fremden Tokio und im Mikrokosmos ihres Hotels nicht viele andere
Gelegenheiten bieten, und stellen einige Gemeinsamkeiten fest, denn
beide befinden sich in einer deutlichen Lebenskrise: Bob - in klassischer
Midlife-Crisis - steckt seit gut zwei Jahrzehnten in einer Ehe,
die offensichtlich jegliches Feuer verloren hat, gleichzeitig fehlt
ihm der Antrieb, etwas an seinem an sich ganz angenehmen Dasein
zu ändern. Charlotte ist noch jung und impulsiv und fragt sich
jetzt bereits, ob ihre Heirat nicht ein Fehler war, während
sie sich gleichzeitig Sorgen macht, emotional schon abgestumpft
zu sein. Gemeinsam brechen die beiden schließlich aus dem
sicheren Hafen ihres Hotels aus und erkunden die fremdartige Welt
Japans.
Im
noblen Park Hyatt Hotel in Tokio begegnen sich - an der Hotelbar,
wo sonst - die beiden Amerikaner Bob (Bill Murray in der vielleicht
besten Vorstellung seiner Karriere) und Charlotte (Scarlett Johansson,
"Ghost World"). Er ein gemachter Schauspielstar, der für
den Dreh eines lächerlichen Whiskey-Werbespots angereist ist,
sie die junge Gattin eines gefragten Fotografen (Giovanni Ribisi),
der auf seinen Reisen nicht wirklich Verwendung für seine Frau
hat. Bob und Charlotte kommen ins Gespräch, weil sich ihnen
im fremden Tokio und im Mikrokosmos ihres Hotels nicht viele andere
Gelegenheiten bieten, und stellen einige Gemeinsamkeiten fest, denn
beide befinden sich in einer deutlichen Lebenskrise: Bob - in klassischer
Midlife-Crisis - steckt seit gut zwei Jahrzehnten in einer Ehe,
die offensichtlich jegliches Feuer verloren hat, gleichzeitig fehlt
ihm der Antrieb, etwas an seinem an sich ganz angenehmen Dasein
zu ändern. Charlotte ist noch jung und impulsiv und fragt sich
jetzt bereits, ob ihre Heirat nicht ein Fehler war, während
sie sich gleichzeitig Sorgen macht, emotional schon abgestumpft
zu sein. Gemeinsam brechen die beiden schließlich aus dem
sicheren Hafen ihres Hotels aus und erkunden die fremdartige Welt
Japans.
 Diese
exotische Fremde ist es auch, die für die erste Hälfte
von "Lost in Translation" der Ursprung des feinen, zielgenau
treffenden und enorm komischen Humors ist. Vor allem Bobs Kampf
mit den Eigenheiten jenes Landes, in dem alles klein, automatisch,
schnell, bunt und irre höflich ist, erscheint dem multikulturell
erfahrenen Zuschauer als wahrhaftig und ehrlich und gerade deshalb
als hoch amüsant. Manche Stimmen warfen Sofia Coppola einen
latenten "Anti-Japanismus" vor, weil sie sich hier über
ihr Gastgeberland lustig machen würde, doch wer so etwas sagt,
hat mal wieder nix verstanden: Interkulturelle Unterschiede sind
ein Fakt der Realität, und die amüsante Note der lieben
Not, sich in einer entsprechend fremden Kultur zu bewegen, hat nichts
mit Intoleranz gegenüber dem Exotischen zu tun, sondern mit
der eigenen Unfähigkeit, sich ausreichend in die andere Mentalität
hineinzuversetzen. Natürlich lacht man über die verrückten
jungen Leute in den Spielhallen oder über den japanischen Bekannten
von Charlotte, der beim Karaoke "God save the Queen" von
den Sex Pistols zum Besten gibt, aber dieses Lachen ist nie böse
gemeint - es ist das Ergebnis eines verwunderten, gänzlich
unschuldigen Staunens ob dieser unverständlichen Andersartigkeit.
Drum ist auch der Titel des Films für sich allein schon
Diese
exotische Fremde ist es auch, die für die erste Hälfte
von "Lost in Translation" der Ursprung des feinen, zielgenau
treffenden und enorm komischen Humors ist. Vor allem Bobs Kampf
mit den Eigenheiten jenes Landes, in dem alles klein, automatisch,
schnell, bunt und irre höflich ist, erscheint dem multikulturell
erfahrenen Zuschauer als wahrhaftig und ehrlich und gerade deshalb
als hoch amüsant. Manche Stimmen warfen Sofia Coppola einen
latenten "Anti-Japanismus" vor, weil sie sich hier über
ihr Gastgeberland lustig machen würde, doch wer so etwas sagt,
hat mal wieder nix verstanden: Interkulturelle Unterschiede sind
ein Fakt der Realität, und die amüsante Note der lieben
Not, sich in einer entsprechend fremden Kultur zu bewegen, hat nichts
mit Intoleranz gegenüber dem Exotischen zu tun, sondern mit
der eigenen Unfähigkeit, sich ausreichend in die andere Mentalität
hineinzuversetzen. Natürlich lacht man über die verrückten
jungen Leute in den Spielhallen oder über den japanischen Bekannten
von Charlotte, der beim Karaoke "God save the Queen" von
den Sex Pistols zum Besten gibt, aber dieses Lachen ist nie böse
gemeint - es ist das Ergebnis eines verwunderten, gänzlich
unschuldigen Staunens ob dieser unverständlichen Andersartigkeit.
Drum ist auch der Titel des Films für sich allein schon  brillant,
spielt er doch gekonnt mit der Erkenntnis, dass es in jeder Kultur
und Sprache Dinge gibt, die sich nicht angemessen übersetzen
lassen, die man als Außenstehender also gar nicht richtig
verstehen kann. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn dann
kann man immer noch Staunen - und Lachen.
brillant,
spielt er doch gekonnt mit der Erkenntnis, dass es in jeder Kultur
und Sprache Dinge gibt, die sich nicht angemessen übersetzen
lassen, die man als Außenstehender also gar nicht richtig
verstehen kann. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn dann
kann man immer noch Staunen - und Lachen.
Ist "Lost in Translation" in diesem Sinne zunächst
vor allem eine intelligente Komödie über dieses merkwürdige
ferne Land Japan, wandelt er sich langsam zu einem ernsthaften Portrait
der besonderen Beziehung zwischen Bob und Charlotte. Fast unmerklich
versteckt Coppola diese atmosphärische Kehrtwende geschickt
in eben jener Karaoke-Szene, bei der man zuerst noch über den
die Sex Pistols imitierenden Japaner lacht. Doch dann greift Bob
zum Mikrofon und singt erst "(What's so funny about) Peace,
Love and Understanding" und dann Roxy Music's sehnsüchtiges
"More than this", und  irgendwo
dazwischen verlassen wir einen Film über Japan und betreten
einen Film über zwei Menschen, die sehr ernsthaft über
die Frage nachdenken, was es für sie tatsächlich noch
geben kann. Der Ort, an dem alles anders ist, wandelt sich zu einem
Ort, an dem alles anders sein kann, und für kurze Zeit genießen
Bob und Charlotte die Sicherheit, die nur eine Reise fern der Heimat
bieten kann. Wo man auf einen gänzlichen Fremden trifft und
den Mut hat, sich diesem zu öffnen, eben weil er ein Fremder
ist.
irgendwo
dazwischen verlassen wir einen Film über Japan und betreten
einen Film über zwei Menschen, die sehr ernsthaft über
die Frage nachdenken, was es für sie tatsächlich noch
geben kann. Der Ort, an dem alles anders ist, wandelt sich zu einem
Ort, an dem alles anders sein kann, und für kurze Zeit genießen
Bob und Charlotte die Sicherheit, die nur eine Reise fern der Heimat
bieten kann. Wo man auf einen gänzlichen Fremden trifft und
den Mut hat, sich diesem zu öffnen, eben weil er ein Fremder
ist.
Dass Sofia Coppola keine Freundin einfacher Lösungen ist,
hat man schon deutlich an ihrem Erstling gesehen, als sie vom kollektiven
Selbstmord von fünf wunderschönen, unschuldigen jungen
Mädchen erzählte und fast konsequent jedes Motiv für
die Tat verweigerte. Entsprechend bleibt bei ihr die besondere Beziehung
zwischen Charlotte und Bob auch eine besondere Beziehung, die ihren
Zauber zu keinem Zeitpunkt durch einen viel zu nahe liegenden Sprung
in die Kiste verliert. Hier geht es um die Möglichkeit von
Verständnis, Erfüllung, Glück, um das Versprechen
von "more than this". Darum steht ihre Beziehung über
einer profanen, physischen Ebene, und darum geht es den Zuschauer
auch nichts an, was sich die beiden in ihrer letzten gemeinsamen
Szene ins Ohr flüstern.
Getragen von seinen zwei gnadenlos brillant agierenden Hauptdarstellern,
Sofia Coppolas eigenen ausgiebigen Erfahrungen als Japan-Reisende
und ihrem unglaublich ausgeprägten Sinn für Ästhetik
(der ja schon "The Virgin Suicides" ausmachte) ist "Lost
in Translation" ebenso komisch wie schmerzhaft ehrlich, ebenso
schön wie faszinierend, und auch bei einem Starttermin am 8.
Januar ganz sicher einer der besten Filme, die man dieses Jahr zu
sehen bekommen kann.
Neuen Kommentar hinzufügen