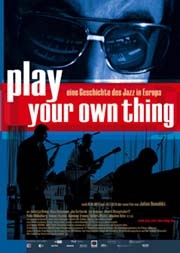
Julian Benedikt liebt den Jazz. Er hört und spielt ihn nicht
nur oft, sondern macht auch viele Dokumentarfilme über seine
Lieblingsmusik. Nach "Blue Note und "Jazz seen" heißt
der neuste "Play your own thing" und ist eine Geschichte
über den Jazz in Europa.
Die Herkunft des Jazz ist so vielseitig und kompliziert wie die
eigentliche Musik. Der Stil mit seinen zahlreichen Wurzeln und Entwicklungen
ist so weit verzweigt, dass es schwer ist, noch von einem einzigen
Genre zu sprechen. Julian Benedikt, selbst ausgebildeter Jazzmusiker,
möchte mit seiner Dokumentation über den Jazz als europäisches
Phänomen und gesamteuropäische Identität sprechen.
Dabei lässt er insgesamt 45 Musiker aus acht Ländern zu
Wort kommen und zeigt Ausschnitte aus Fernsehaufnahmen und Konzerten
aus den 50er, 60er und 70er Jahren.
 Die
Geschichte des europäischen Jazz begann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Amerikanische GIs brachten die Musik in die ehemaligen Kriegsschauplätze,
und mit dem Aufbruch in eine neue politische Ära änderte
sich auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und Freizeit. Nach
den Jahren der Entbehrungen im Krieg und der totalitären Verhältnisse
in Deutschland und Österreich läutete der Jazz ein neues
und leichteres Lebensgefühl in Europa ein.
Die
Geschichte des europäischen Jazz begann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Amerikanische GIs brachten die Musik in die ehemaligen Kriegsschauplätze,
und mit dem Aufbruch in eine neue politische Ära änderte
sich auch das Bedürfnis nach Unterhaltung und Freizeit. Nach
den Jahren der Entbehrungen im Krieg und der totalitären Verhältnisse
in Deutschland und Österreich läutete der Jazz ein neues
und leichteres Lebensgefühl in Europa ein.
Die ersten Jazzbands kopierten die amerikanische Musik, und so fanden
in den alten und baufälligen Clubs der Großstädte
die ersten Jazzkonzerte statt, mit amerikanischen und europäischen
Künstlern. Erst in den 60er Jahren entwickelten sich dann allmählich
eigene Stilrichtungen und die verschiedenen Künstler versuchten
ihren Songs eine eigene und unverwechselbare Stimme zu geben. In
den Jazzszenen trafen sich Schriftsteller, Maler und andere Intellektuelle,
die nach kultureller Vielfalt und neuer Lebensfreude strebten. So
bekam der Jazz in jeder Stadt einen anderen, individuellen Charakter.
Nach und nach erzählen Jazzmusiker wie Dee Dee Bridgewater,
Paul Kuhn, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Stefano Bollani
und Coco Schumann von ihren ersten Begegnungen mit dem Jazz, ihrem
Leben in der Szene und ihrem persönlichen Bezug zur Musik.
Doch leider ließ Julian Benedikt zu viele Künstler zu
Wort kommen, und die einzelnen Sätze und Erzählfragmente,
die zu der Musik und den Konzertausschnitten eingeblendet werden,
bleiben zusammenhangslos im Raum stehen. Weder erfährt der
Zuschauer von dem Werk, dem Einfluss und den Erfahrungen der vorkommenden
Personen, noch wird ihm ein Zugang zu ihnen gewährt, zu schnell
geht es mit dem nächsten Musiker weiter. Wer den Film nicht als schon komplett vorgebildeter
Szenekenner sieht, hat hier kaum eine Chance, mitzukommen.
Musiker weiter. Wer den Film nicht als schon komplett vorgebildeter
Szenekenner sieht, hat hier kaum eine Chance, mitzukommen.
Zudem hat sich der Regisseur und Produzent das hohe Ziel gesetzt,
die Länder England, Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark,
Ungarn und die DDR einzeln vorzustellen, und kann dabei nur vorsichtige
Außenansichten abliefern, statt die Szene in ihrer Vielfalt
wirklich klar vorzustellen. So berichtet die Französin Juliette
Gréco lediglich, sie sei in den 60er Jahren so verliebt gewesen,
dazu wird ein Liebespaar im Sonnenuntergang eingeblendet. Noch während
man sich fragt, wo denn da der Zusammenhang bleibt, vergleicht Gianluigi
Trovesi aus Italien den Jazz mit einer Pizza: Auch wenn man andere
Zutaten nimmt, bleibt die Definition erhalten.
Benedikt hatte das ohne Zweifel lobenswerte Anliegen, den Jazz aus einer persönlichen Perspektive zu erzählen, und dieser Ansatz ist gerade für eine so eigene und vielschichtige Musikrichtung wie den Jazz gut gewählt. Doch anstatt die Zitate und Interviews zu Informationen zu ordnen, verirrt sich der Zuschauer bald in den vielen Eindrücken und oft widersprüchlichen Aussagen. Weder die Personen, noch die von ihnen beschworenen Emotionen schaffen den Sprung über die Leinwand, zu blass und zu angedeutet bleibt alles im Raum stehen. Während betont wird, dass der Jazz eine starke Musik ist, für die jeder seine eigene Stimme finden muss, bedauert man, dass der Film dies nicht schafft.
Falls Julian Benedikt für den Jazz werben wollte, ist ihm
dies nicht gelungen, eher gewinnt man den Eindruck, einen Film über
eine veraltete und untergegangene Musik zu sehen. Lediglich Musikhistoriker
mit Spezialisierung auf Jazz werden die Dokumentation zu schätzen
wissen, für eine breite Gruppe interessierter Zuschauer tut
sich ein Rätsel auf.
Juliette Gréco redet davon, dass die Jazzszene eine eingeschworene
Gruppe mit eigener Sprache und eigenen Idealen war. Diese Einschätzung
überträgt sich leider auch in den Kinosaal: Selten hat
man sich als Nicht-Experte in einer Dokumentation so ausgeschlossen
und fehl am Platz gefühlt.
Neuen Kommentar hinzufügen