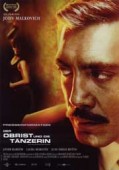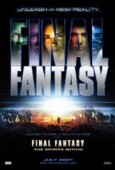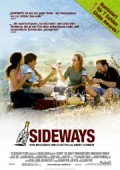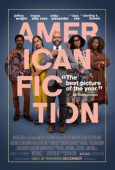Im Gespräch
filmszene.de wurde im Februar 1999 gegründet als Hobby-Projekt einiger filmverrückter Studenten. Bis heute schreiben wir hier nach Lust, Zeit und Laune über unsere große Leidenschaft, um sie mit Gleichgesinnten zu teilen. Von Filmfans, für Filmfans.
© 1999 - 2024 Filmszene.de
Copyright © 2024. All rights reserved.